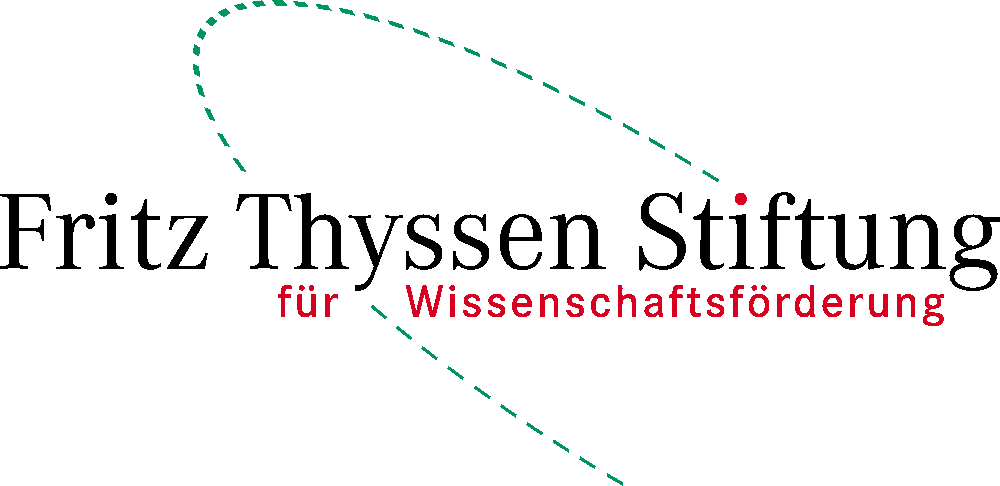Wilhelm von Humboldt an Friedrich Gottlieb Welcker, 06.11.1821
Berlin, den 6. November, 1821.Ich habe Ihnen, liebster Freund, verwichenen Sonnabend nur einige Zeilen geschrieben, weil ich die Muße nicht hatte, Ihre beiden mir sehr werthen Schreiben an diesem Tage ordentlich zu beantworten. Auch das letzte vom 23. Aug. ist mir erst in der Mitte Octobers zugekommen. Es hatte alle Reisen auf meine Landgüter gemacht, die ich selbst im letzten Sommer vorgenommen hatte, u. dies muß den Aufschub bewirkt haben.
Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Andenken, u. die Nachrichten über Ihr Befinden, u. Ihre Beschäftigungen, nicht weniger für die gütige u. nachsichtsvolle Beurtheilung meiner Schrift. Ich wünsche mit wahrer Ungeduld, daß Sie die nöthige Muße zur Bearbeitung Ihrer Griechischen Religionsgeschichte gewinnen mögen. Es ist einer der wichtigsten Gegenstände, über die man jetzt schreiben kann, allerdings auch einer der schwierigsten. Allein bei der großen Ruhe u. Unpartheilichkeit, die Sie immer zu wissenschaftlichen Untersuchungen mitbringen, wird es Ihnen mehr, wie jedem andren, auch sonst gleich gelehrten u. fähigen, gelingen, Sich von Systemsucht freizuhalten.
Die Arbeiten Ihres Freundes bin ich mit großem Vergnügen durchlaufen, u. habe ihn darin, wie Sie ihn mir beschrieben, gefunden. Noch mehr hatte ich mir schon früher seine Beurtheilung des Agamemnon, ohne daß ich wußte, von wem sie herrührte, gefallen.[a] Ich konnte allerdings mit Einigem darin nicht übereinstimmen, aber abgerechnet, daß ich sehr Ursache hatte mit der Art zufrieden zu seyn, mit der er mich behandelt hatte, lag auch eben in dem etwas schroffen, abgerißnen, mit unter dictatorischen Ton die Lebendigkeit u. das Geistvolle, was man bei so vielen Arbeiten dieser Art vergebens sucht. Auch der Callimachus hat mir sehr gut gefallen. Nur wäre doch dem Hexameter mehr Strenge u. Feile zu wünschen. Bei diesem vermisse ich, wie ich nicht läugne, noch viel. Allein auch darüber ist das Urtheil verschiedner verschieden, u. so möchte ich nicht entscheiden. Die besten Hexameter, die wir bis jetzt besitzen, sind, meinem Gefühl nach, die Schlegelschen u. die 100 die Wolf in den Analecten aus der Odyssee übersetzt hat.
Da ich H. Schwenck nicht selbst mit einem schriftlichen Danke für seine Zueignung u. seine Mittheilungen beschwerlich fallen will, so bitte ich Sie, ihn ihm recht lebhaft in meinem Namen zu sagen. Sein Urtheil über meine Uebersetzung u. mich, das sich auch darin ausgesprochen hat, ist wirklich von großem Werthe für mich, u. sein Beifall ist mir daher doppelt angenehm gewesen. Es ist schon viel, wenn man in jetziger Zeit nur ernstlich geprüft wird, u. ich bin namentlich überzeugt, daß eine solche Prüfung meinem Agamemnon nur von Wenigen in dem Grade, wie von ihm, zu Theil geworden ist.
Ihren Wunsch, Ihrem Freunde eine Anstellung bei uns zu verschaffen, werde ich sehr gern, soviel ich kann zu befördern suchen. Allein ich kann Ihnen nicht läugnen, daß ich das Gelingen für schwierig halte. Es sind jetzt wohl nicht einmal Universitätsstellen offen, auch sieht man dabei, obgleich man daran, meiner Meynung nach, nicht immer recht thut, zu oft auf schon allgemein anerkannten Ruf. Für eine Schulstelle würde ich H. Schwencks Hypochondrie fürchten. Der Schulunterricht fordert eine Heiterkeit, die ihm um so leichter fehlen könnte, als eine Schulstelle ihn auch nicht einmal sehr reizen wird. Minister Altenstein ist in diesem Augenblick krank, u. so war es mir unmöglich, ihn zu sprechen. Mit Süvern dagegen habe ich gleich geredet. Er erwähnte auch mehr die Schwierigkeiten, als er Hofnungen gab. Er rieth indeß, daß H. Schwenck, da er im Winter in Bonn bleiben will, u. ihm seine jetzige Stelle Muße läßt, Collegia anschlagen u. lesen möchte. Dies schiene auch mir sehr passend. Hätte er Beifall, so bekundete er dadurch sein Talent zum mündlichen Vortrag. Seinen mir überschickten Brief behalte ich zurück, bis Sie ihn mir vielleicht abfordern.
Von meinen Sprachbeschäftigungen wird Ihnen die Ihnen neulich übermachte Abhandlung einen kleinen Begriff geben. Mein nächster Vorwurf ist, zu untersuchen, in wiefern die Verschiedenheit des grammatischen Baues der Sprachen auf die Tauglichkeit dieser zu jeder Art der Ideenentwicklung einwirkt. Ich möchte dies indeß mehr historisch, als bloß aus Ideen behandeln, u. dazu bieten mir die Amerikanischen Sprachen einen sehr günstigen Stoff dar. Sie stammen alle sichtbar aus einer frühen Epoche der Sprachbildung, und wenn gleich auch sie schon viel zu alt (oder jung) sind, um an ihnen das Werden der Sprache selbst zu erkennen, so bemerkt man dennoch an ihnen deutlich das Werden gewisser grammatischer Formen. Es ist übrigens wichtig, so viele Ideen, die man über sie u. alle wilde |sic| Sprachen bisher hatte, an ihnen zu berichtigen u. fest zu bestimmen. Denn man kann mit Wahrheit sagen, daß sie die Gattung der Sprachen der Wilden fast vollständig repraesentiren. Was wir in dieser Art von den andren Welttheilen besitzen, ist im Grunde nur wenig. In Amerika haben die Missionarien unglaublich viel gethan. Davon ist freilich ein bedeutender Theil untergegangen, u. ein andrer mit den Menschen, den Exjesuiten, hingestorben. Aber der selige Hervas in Rom hatte noch aus mündlicher tradition Vieles gerettet, u. ich habe wieder durch Abschriften, die ich damals machen ließ, seine Sammlungen größtentheils erhalten. Denn die Originalpapiere sind nach seinem Tode zerstreut worden, ohne daß man weiß, wer sie besitzt. Alles das hat freilich Vater im Mithridates benutzt. Aber der Zweck dieses Buchs beschränkt seinen Raum viel zu sehr, u. dann möchte ich sagen, fehlt es ihm auch an dem Talent, das Charakteristische aufzufassen. Wenn Sie seine grammatischen Schilderungen ansehen, werden Sie eigentlich gar nicht dadurch zu einem Resultat, kaum zu einer Bemerkung geleitet. Ich habe also die ganze Arbeit von neuem aufgenommen, u. aus allen Quellen, die ich mir habe verschaffen können, nunmehr etwa 20 Specialgrammatiken zusammengetragen. Ueber mehr als höchstens 30 Amerikanische Sprachen besitzt man nicht so umständliche Nachrichten, als zu meinem Zweck erfordert wird, u. somit bin ich von der Vollendung der Vorarbeiten nicht so sehr weit entfernt. Aus diesen denke ich nun eine allgemeine Abhandlung zu bilden, welche das Charakteristische des grammatischen Baues dieser Sprachen darstellen, prüfen soll, in wie weit sie unter sich übereinkommen, oder abweichen, wie sie sich von den Sprachen des übrigen Erdballs unterscheiden, u. bestimmen, was davon bloß aus ihrem sonst gemeinsamen Charakter, daß sie von Nationen auf der ersten Culturstufe gebildet sind, herfließen kann. Ob ich an diese Abhandlung gleich auch knüpfen werde, was in jener oben berührten mehr philosophischen Ansicht auseinander zu setzen ist, weiß ich nicht, aber von sehr großem Nutzen für diese letzte Arbeit muß nothwendig die erstere seyn. Denn soviel ich jetzt sehen kann, wird sich zeigen, daß jene Sprachen noch gar nicht die Stufe grammatischer Bildung erlangt haben, daß sie das formale Denken zu befördern im Stande sind, so reich sie auch an Ausdrücken u. selbst Formen für die Materie des Denkens, selbst wo sie geistige Gegenstände betrift, sind. Auf der Stufe der Beförderung des formalen Denkens steht, wenn man die Sprachen rückwärts, von den gebildetsten zu den ursprünglichen hinauf durchgeht, erst das Sanskrit, aus dem alle grammatische Form der klassischen u. unserer Sprachen herstammt. Aber zwischen dem Sanskrit u. dem Griechischen scheint nun wieder eine Kluft zu liegen. Denn ich halte das Sanskrit nicht für den vollendeten Ideengebrauch fähig. Als das Zeichen u. das Resultat von diesem sehe ich die ausgebildete Prosa an, u. ich glaube nicht, daß man diese über die Griechen zurück hinaus aufsuchen darf. Hier sehen Sie nun auch den Grund, der mich bewogen hat, mich so ernstlich mit dem Sanskrit zu beschäftigen, als ich seit einem Jahre thue. Ich habe jetzt ziemliche Fortschritte gemacht, u. mich überzeugt, daß wer wahrhaft Sprachstudium auf eine zugleich gründliche, u. für den Geist interessante Art (nicht bloß um Schälle u. Formen zu vergleichen) treiben will, des Sanskrits in nicht zu geringem Grade mächtig seyn muß. Es ist in meiner Ansicht ein Centrum von dem man zurück auf die minder ausgebildeten Sprachen, um den Mechanismus der Sprache zu beurtheilen, u. vorwärts auf die höher ausgebildeten, um die Fähigkeit der Sprache zur Ideenentwicklung zu beurtheilen, gehen kann. Ich sage indeß die |sic|[b] nur zu Ihnen, den Enthusiasten für die Indische Sprache würde ich mit so kühnen Behauptungen nicht entgegentreten mögen. Sie würden nicht zugeben, daß eine Sprache höherer Ausbildung fähig sey, u. meine noch mangelhafte Kenntniß des Sanskrits anklagen. Allein ich glaube doch Recht zu haben, so sehr ich die Mängel meiner Kenntniß des Sanskrits allerdings anerkenne.
Bopp wird wahrscheinlich hier in Berlin, als Professor bleiben. Er ist nur noch nicht recht mit seiner Regierung darüber im Reinen. Sein Umgang ist in jeder Rücksicht von großem Werthe für mich.
In meinem Hause geht es jetzt wieder recht gut, doch hat meine Schwiegertochter den Unfall gehabt, vor einigen Tagen falsche Wehen zu halten. Glücklicher Weise hat aber Ihre |sic| Gesundheit dabei nicht gelitten.[c] Meine Frau ist recht leidlich gesund, u. meine Töchter sind es sehr. Gabriele wird wohl noch am Ende des Jahres, oder im Anfang des folgenden Mutter werden. Sie grüßen Sie alle freundschaftlichst.
Erhalten Sie mir Ihr gütiges Andenken u. leben Sie herzlich wohl!Mit der hochachtungsvollsten Ergebenheit
der Ihrige,
Humboldt
Noch vergaß ich zu erwähnen, daß
Wolf gegen mich mit sehr vielem Lobe
von der
Schwenckschen Ausgabe der beiden Stücke des Aeschylus
sprach.