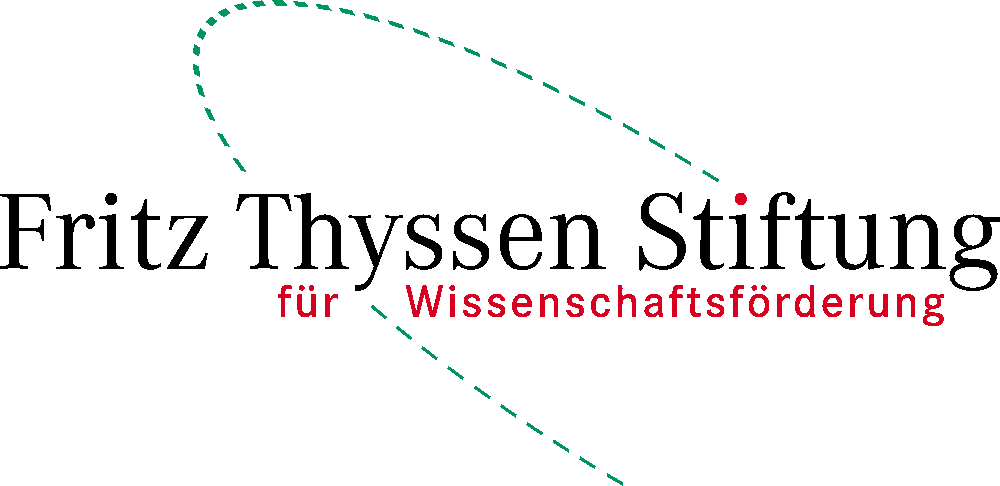Wilhelm von Humboldt an Friedrich Gottlieb Welcker, 10.10.1826
Ich danke Ihnen herzlich, theuerster Freund, für Ihren gütigen und freundlichen Brief vom 16. v. M. und bitte Sie ja, nie über ein längeres Stillschweigen von Ihrer Seite in Verlegenheit zu seyn. So gern ich Ihre Briefe empfange, möchte ich nie, daß Sie Sich darum in wichtigeren Arbeiten störten, oder zu einer Zeit schrieben, wo Sie nicht die rechte Stimmung dazu fühlen. Nur unter diesen gegenseitigen Bedingungen kann man sich selbst auf freundschaftlichen Briefwechsel einlassen.
Meine Frau, die mit Carolinen Sie herzlich grüßt, war wirklich, als sie ihre Badereise antrat, recht leidend, und mehr, als das, wirklich bedenklich und gefährlich krank. Glücklicherweise hat das Bad kräftiger gewirkt, als wir zu hoffen gewagt hatten. Das Befinden ist seit der Rückkehr ungemein besser, die Kräfte gehoben, alle Symptomen des Uebels gemindert, das Aussehen mit dem im Frühjahr nicht zu vergleichen und Lebensmuth und Heiterkeit zurückgekehrt. Bei einem einmal sehr eingewurzelten gichtischen Uebel kann man niemals wissen, ob nicht der Winter es wieder sehr verschlimmern kann, ist das aber nicht der Fall, so läßt sich mit Grunde hoffen, daß ein nochmaliger Gebrauch Gasteins eine völlige Wiederherstellung bewirken wird. Wie viel beruhigter und freudiger mich dies in die Zukunft blicken läßt, die mich vorher sehr bekümmerte, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, und da Ihre Freundschaft für uns, Ihren Antheil an unsren Schicksalen kenne, so ist es mir ein wahrer Genuß, Ihnen diese erfreulichen Nachrichten mit-theilen zu können.
Bachs habe ich mich mit Vergnügen angenommen, da Sie, liebster Freund, ihn mir empfohlen hatten, und mir sein Fleiß und seine Kenntnisse eine günstige Meinung von ihm einflößten. Seine Geschichte in Bonn kenne ich durchaus nicht, ich habe sie mir nicht einmal von ihm selbst erzählen lassen. Ich hasse alle Theilnahme an Dingen dieser Art, u. war gewiß, daß, wenn Bach sich auf eine Weise, die seinem Charakter keine Ehre machte, darin genommen hätte, Sie mich vor ihm gewarnt haben würden, da Sie mir ihn empfohlen hatten. Hat er sonst darin gefehlt, so ist er hart genug dafür bestraft, da er, statt am Rhein eingestellt zu werden, nach Oppeln gekommen ist. Dort weiß und höre ich nur Vortheilhaftes von ihm.[a]
Ihre Theilnahme am Kunstverein […]
Meine Abhandlung über die Bhagavad-Gitá habe ich sous bande für Sie auf die Post gegeben.[b] Nehmen Sie, liebster Freund, sie mit gewohnter Güte und Nachsicht auf. Meine Absicht ist, daß das Gedicht auch unter denen bekannt werde, die nicht Sanskrit wissen. So treflich die Schlegelsche Uebersetzung ist, so liest sie niemand, u. wer sie liest, lernt doch das Gedicht nicht kennen. Man ermüdet über den Wiederholungen, Einschaltungen u. s. f. Es ist durchaus nothwendig, das Einzelne, wie ich gethan, anders zu ordnen, zugleich zu sichten, u. geradezu nicht Alles zu geben. Dann ist auch das Lateinische gerade die Sprache, in die man so etwas nicht übersetzen darf. Endlich sehen die Menschen Lateinische Uebersetzungen bei Sanskritoriginalen wie Eselsbrücken für Sanskritlernende an, u. überschlagen sie. Meine Abhandlung ist aus einer wahrhaft ungemeinen Liebe zu dem Gedicht entstanden. Ob diese vor Lesern, wie Sie, mein Bester, u. andren, die alle Bedingungen zum entscheidenden Urtheil mit der Art Partheilosigkeit, die die Nichtbeschäftigung mit der Ursprache giebt, verbinden, sich durch meine Arbeit rechtfertigen wird, ist die Frage. Die deutsche metrische Uebersetzung hätte Schlegel unbedenklich viel besser gemacht, ich habe aber die eigne Treue hineingelegt, die wenigstens ich bei andren, auch Schlegelschen Uebersetzungen, bisweilen vermisse. Ich wünsche sehr, recht bald Ihr Urtheil zu erfahren.
Die Schmidtsche Arbeit über den Infinitiv schätze ich auch. Nur genügt mir seine Widerlegung meiner Meinung nicht, u. seine grammatische Grundidee kann ich nicht billigen. Er hätte nicht von der Bernhardischen abgehen, sondern diese vielmehr tiefer studiren sollen, wie er sichtlich nicht gethan. Ich habe ihm weitläuftig darüber geschrieben.[c] Es ist überhaupt ein eignes Ding, daß jetzt die Menschen so gern eigne Theorien aufstellen, ohne die bisherigen zu prüfen u. zu widerlegen. Auch dem jungen Görres muß ich das vorwerfen. Sein Begriff des Verbum ist sichtlich falsch u. er konnte den richtigen aus Bernhardi schöpfen.
Doch danke ich Ihnen sehr für seine Bemerkungen. Da ich ihn erst in einem halben Jahr hier sehen könnte, so veranlassen Sie ihn doch, mir seine Preisschrift mitzutheilen. Ich werde dann auf seine Bemerkungen, die einen guten, wenn auch nicht klaren Kopf verrathen, antworten.[d]
Leben Sie herzlich wohl! Mit der innigsten u. hochachtungsvollsten Freundschaftder Ihrige,
Humboldt.
Tegel, den 10. October, 1826.
Fußnoten
- a |Editor| Der Abschnitt von „Seine Geschichte …“ bis zum Ende des Absatzes fehlt bei Haym 1859.
- b |Editor| Der Gesamtband der Abhandlungen erschien erst im Jahr 1828, der Beitrag von Humboldt wurde aber bereits im Herbst 1826 gedruckt; siehe auch Leitzmann in: GS V, S. 479. [FZ]
- c |Editor| Siehe Briefkonzept vom 28. Oktober 1826 (Coll. ling. fol. 55, Mappe 4, Bl. 60–69, Krakau). Humboldts Brief an Maximilian Schmidt wurde unter dem Titel "Ueber den Infinitiv" in der Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 2, 1853, S. 241–251, veröffentlicht. [FZ]
- d |Editor| Siehe "Erwiderung auf einen Aufsatz von Guido Görres" (Handschrift, AST), in: GS VII/2, S. 645–649, mit der Wiedergabe des handschriftlichen Aufsatzes von Görres, der über Welcker an Humboldt gelangte, auf S. 649–652. [FZ]