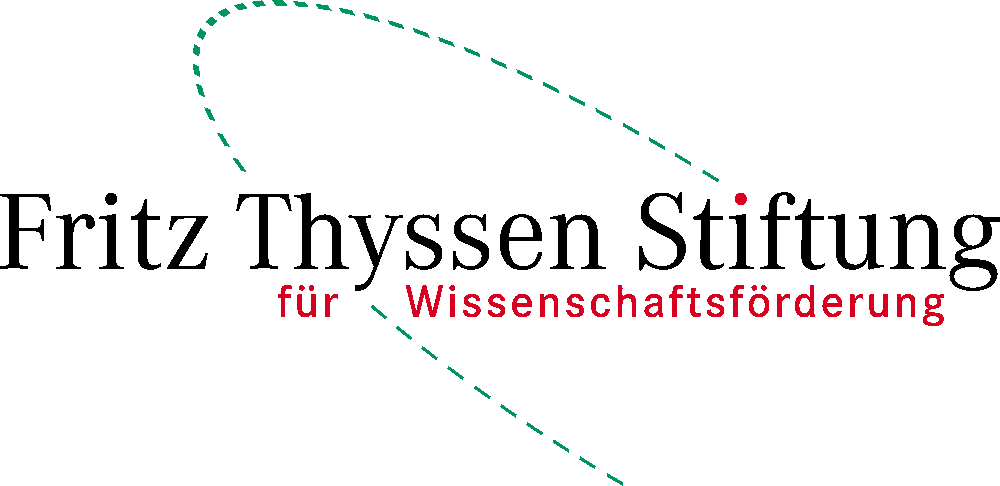Wilhelm von Humboldt an Friedrich Gottlieb Welcker, 03.12.1828
|1*| Berlin, den 3. December, 1828.Ich habe, theuerster Freund, bei meiner Rückkehr hier Ihren gütigen Brief vom 9. September gefunden, und kann Ihnen nicht sagen, wie sehr er mich gefreut, hat und wie unendlich ich die Güte und Liebe erkenne, mit welcher Sie immer fortfahren, mit alter Freundschaft und wahrer Anhänglichkeit an mich und die Meinen mir zu schreiben. Ich habe zwar in Ihren Epigrammen Mehreres und mit großem Interesse gelesen, es thut mir aber doch leid, daß ich gerade der Art das griechische Alterthum zu studiren, in der Sie die Kenntniß desselben von so vielen Seiten so schön erweitern, jetzt fremder geworden bin. In der Sprache glaube ich zwar mich befestigt zu haben und selbst zu einer Einsicht gekommen zu seyn, zu welcher die Philologie auf dem herkömmlichen Wege nicht führt. Ich habe erst in diesem Jahre eine Arbeit über die Attische Reduplication und Einiges damit Zusammenhängende gemacht, die bald gedruckt werden wird. Aber das Lesen der Schriftsteller, und der ästhetische u. antiquarische Theil des Studiums leiden natürlich, da ich in meinen hauptsächlichen Untersuchungen eine andre Richtung genommen habe. Ich muß aber nun schon diesen Weg, da ich ihn einmal eingeschlagen, verfolgen, ich sehe diese Untersuchungen auch nicht als etwas ins Unendliche Ausgehende |sic| an. Hätten sie bloß gewissermaßen äußerlich alle Sprachen zum Endzweck, so wäre der Sache wirklich kein Ziel zu setzen. Allein mein Zweck ist viel einfacher, und gleichsam ein esoterischer, nämlich ein Studium, welches die Sprachfähigkeit in ihrem Innern, als menschliche Fähigkeit behandelt, u. ihre Wirkungen, die Sprachen, nur als Quellen der Kenntniß und Beispiele bei der Entwicklung benutzt. Ich möchte zeigen, daß dasjenige, was eine Sprache zu dieser oder jener bestimmten macht, ihr grammatischer Bau ist, u. nun zu entwickeln, |2*| wie der grammatische Bau in allen seinen Verschiedenheiten doch nur gewissen, einzeln aufzuzählenden Methoden folgen kann, so daß sich bei dem Studium jeder Sprache zeigen läßt, welche Methoden in ihr herrschend, und oder gemischt sind. Mit diesen Methoden selbst aber betrachte ich natürlich den Einfluß jeder auf den Geist und das Gemüth, und ihre Erklärung aus den Entstehungsursachen der Sprachen, insoweit dies möglich ist, und knüpfe also das Sprachstudium an die philosophische Uebersicht der Bildungsfähigkeit des Menschengeschlechts und an die Geschichte. Ich bin seit einigen Jahren mit einem Werke hierüber beschäftigt, und sehr weit darin vorgerückt. Allein erst der Gasteiner Aufenthalt in diesem Jahr hat meine Ideen über diese Punkte zu einer gewissen Reife gebracht. Ich kann nicht dankbar genug erkennen, daß ich hierin das Meiste dem fortgesetzten Studium des Sanskrits schuldig bin. Es liegt in dieser wunderbaren Sprache ein so unendlicher Stoff zu grammatischen Betrachtungen und Wahrnehmungen nach allen Seiten, auch nach denen unvollkommneren Baues hin, daß er nie wird ganz erschöpft werden können. Es ist besonders wichtig mit ihr andre Indische Sprachen, die, ob sie gleich später eine starke Mischung mit ihr erfahren haben, ursprünglich ganz andren und sehr unvollkommenen Baues sind, wie das Tamulische und Telugusche zu vergleichen. Zu beiden Sprachen habe ich aus London trefliche und sehr seltne Materialien mitgebracht, und mich mit ihnen schon ziemlich vertraut gemacht. Leider fehlen aber dazu noch viele Hülfsmittel, die erst geschaffen werden müssen. Ich erzähle Ihnen dies nur, theuerster Freund, um Ihnen zu sagen, auf welchem Wege der Forschung ich bin, u. wie ich meine Studien nicht als eine Beschäftigung der Muße, sondern als ein Bestreben ansehe, etwas zu Stande zu bringen, das man hernach weiter ausführen, einen Grund zu legen, auf dem man fortbauen kann. Glücklicherweise ist meine Gesundheit gut, u. ob ich gleich das eine meiner Augen zum Arbeiten gar nicht mehr brauchen kann, und das andre schwach ist, so geht es doch auch damit so, daß es mir bis jetzt nicht zum ernstlichen Hinderniß |3*| wird. Ich wollte, ich könnte Ihnen ebenso Erfreuliches und Beruhigendes über die Gesundheit meiner Frau sagen. Leider aber ist das nicht ganz der Fall. Gastein scheint sie zwar von allen gichtischen Beschwerden geheilt zu haben. Allein es haben sich seit einiger Zeit andre Beschwerden und Uebel, denen man nicht einmal einen bestimmten Namen geben kann, eingefunden, an denen sie gelitten hat, und die sie noch mehr nervös angegriffen haben. Es fing unterwegs an, ohne daß die Reise daran im mindesten Schuld zu seyn schien. Hier nach unsrer Ankunft hatte es zugenommen, allein glücklicherweise hat sich seit Kurzem eine merkliche Besserung eingestellt, und es scheint mir nun auf einem recht guten Wege zu seyn. Uebrigens war meine Frau nie bettlägerig dabei, und nie gehindert an Gespräch und Umgang bei sich Theil zu nehmen. Der Aufenthalt in Paris und London hat sie sehr interessirt und erfreut. England war ihr ganz neu, sie hat sich in London von aller uninteressanten Gesellschaft befreit, und ihre Kräfte nur auf das Besehen anziehender Dinge verwandt. Wir haben vorzüglich sehr viel Gemälde gesehen, an denen in London ein ungemeiner Reichthum ist. So angenehm uns dort das Leben bei unsern Kindern war, so schmerzlich ergriff aber meine Frau die Trennung. Die Entbehrung der Tochter und Enkelinnen macht natürlich auch, daß jedes körperliche Uebel sie mehr angreift, und die Genesung und Erholung davon langsamer und schwieriger ist. Es ist wirklich traurig, daß uns dies in diesen Jahren unsers Alters trifft, aber freilich auch ist es ein Schicksal, dem man, wenn man Töchter verheirathet, selten ganz entgeht. Mir ist die Reise in der mannigfaltigsten Rücksicht nützlich und angenehm gewesen. Ich war genau vier Wochen in Paris und achte in London und habe mich in dieser Zeit in beständiger Thätigkeit erhalten. Ich habe eine Menge neuer Bekanntschaften gemacht und Verbindungen geknüpft, die mir für meine Forschungen noch dienlich sind. Vorzüglich aber hat es mich angezogen u. ergötzt, wieder einmal und kurz (denn lange würde es keinen Werth für mich haben) in dem großen Gewühle dieser mit keinen andren zu vergleichenden Städte zu seyn. Dagegen contrastirte die Einsamkeit, die fast absolute, in Gastein. Der Ort, seine Lage, das Leben da, die Stille, die wunderschöne Natur eben, kurz Alles, wie es da zusammen ist, ist mir |4*| werth u. ich verlasse es immer nur mit Bedauern. Jetzt bleibe ich bis zum Frühjahr hier, wo ich, doch nur auf Wochen, auf meine Güter nach Schlesien gehen muß. Caroline würden Sie viel gesünder, als ehemals finden. Sie ist wirklich recht wohl, und sehr mit Lernen des Englischen, das sie auch schon recht gut weiß, beschäftigt. Mein ältester Sohn lebt mit seiner Frau u. seinem Sohn theils in Ottmachau, theils in Breslau, u. ist wohl und vergnügt. Ebenso Adelheid. Mein jüngster Sohn wird jetzt das Gymnasium verlassen, aber nicht auf die Universität gehen, sondern sich dem Forstfach widmen. Er ist ein sehr guter, liebenswürdiger Mensch, der alle Leute für sich einnimmt, aber zeigt mehr praktische Anlage, als Neigung zum Studium. So wissen Sie, da Sie ja, liebster Freund, so gütigen Antheil an uns nehmen, von der ganzen Familie. Meine Frau u. Caroline grüßen Sie herzlich. Leben Sie innigst wohl u. erhalten Sie mir Ihre liebvolle Freundschaft.[a] Mit der Mittheilung der Recension haben Sie mich sehr verpflichtet. Ich lese leider gar keine Zeitungen.
Mit der innigsten u. hochachtungsvollsten Freundschaft der IhrigeH.
Fußnoten
- a |Editor| Die Passage von „Caroline würden Sie viel gesünder …“ bis hierher fehlt bei Haym 1859, S. 147. [FZ]