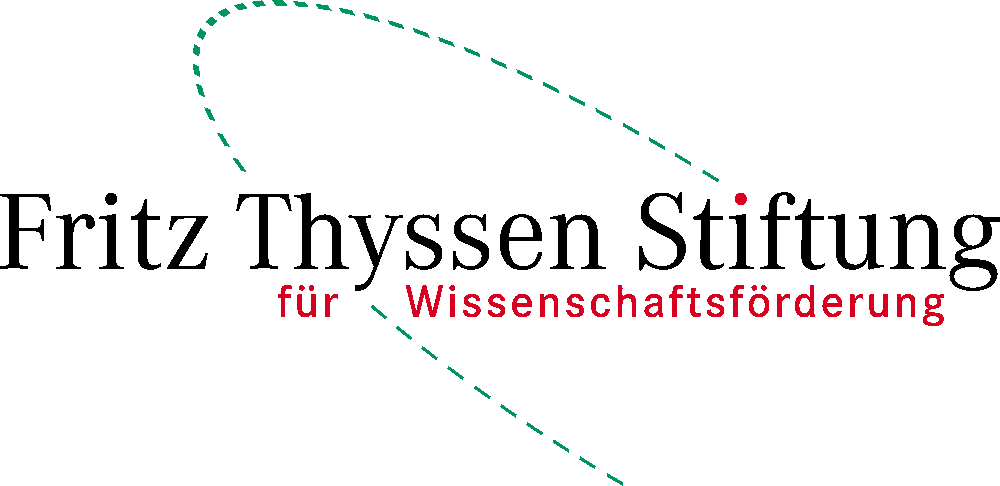Wilhelm von Humboldt an August Wilhelm von Schlegel, 30.12.1822
|1*| Berlin, den 30. December, 1822.Ich schicke Ew. Hochwohlgebohrnen anliegend die Bemerkungen, welche eine Beilage Ihres vorletzten Schreibens ausmachten. Ich habe mir den Inhalt derselben für mich excerpirt. Es wird mich sehr freuen, wenn Sie den Anfang meines Aufsatzes im 4. Heft Ihrer Bibliothek wollen abdrucken lassen. Ihren letzten gütigen Brief vom 21sten erlauben Sie mir wohl auch, wenn gleich nur kurz, auf der Stelle zu beantworten.
Daß Sie der Universität regelmäßig Ihre Vorlesungen widmen, ist gewiß sehr schön, u. wieviel Antheil ich auch an Ihren Indischen Studien nehme, so kann ich nicht wünschen, daß es anders seyn möchte. Ein Mann von Ihrem Geiste, von solchem Umfange vielseitiger Gelehrsamkeit, u. einer so bestimmt auf das Philosophische u. Dichterische hingewandten Richtung darf sich nicht zu sehr in das bloß philologische Studium Einer Sprache, und noch dazu einer solchen einschließen, die noch gar manches mechanisches Treiben fordert. Es war mir schon oft erfreulich von jungen Leuten, die aus Bonn zurückkehrten, zu hören, welcher lebhafte Antheil an Ihren Vorlesungen dort allgemein herrscht, u. wie wohlthätig Sie dadurch auf den Geist u. die Richtung der Studirenden einwirken. Sehr schön ist es, daß Sie schon einen zum Abschreiben von Handschriften tüchtigen Schüler gebildet haben. Soviel, als möglich, Handschriften abschreiben, ist jetzt eine Hauptsache, u. bei der Vortreflichkeit u. Lesbarkeit des Devanagari müßte es selbst einem, der wenig wüßte, aber nur genau wäre, nicht schwer fallen. Nur hörte ich freilich in London manchmal sagen, daß man, um neue u. wichtige Lesarten zu finden, vorzüglich die Handschriften in Bengalischer Schrift aufsuchen muß.
Die Handtrommelstelle im Hitopadesa (Londoner Ed. 53, 11. 12.) hat mich sehr lachen gemacht. Sie übersetzen das Ende des ersten Verses: |2*| durch deren Mangel selbst Elephanten in solche Knechtschaft gerathen. Allein, nicht wahr, Sie meynen damit auch, daß eine ganz wörtliche Uebersetzung nur seyn würde: (in) welcher (d. h. der Klugheit) Mangel jener der Zustand der Elephanten (ist.) Der locativus kann, dünkt mich, hier ganz eigentlich genommen werden, obgleich man auch das Participium des verb. subst. ergänzen u. ihn so zum locativus absolutus machen könnte.
Ueber die Stelle im
Nalas weiß
ich doch nicht, ob ich Ihrer Meynung beipflichten möchte. Was {svāni} betrift, so
glaube ich zwar, daß es ebensowohl „Deine“ heißen könnte, obgleich mir auch dies
nicht ganz ausgemacht ist. Es ist in sich „selbst, eigen“, u. insofern, wie auch
{ātman} auf alle drei
Personen verwendbar. Dies hat auch
Bopp (Nal. Anm. 115.) bemerkt. Wenn nun einer zum andern spricht, so
wird es die 1. oder 2. Person, je nachdem man es strenge auf die eine, oder
andre bezieht.
Nalas XII. 56.
a. ist es in einem ganz ähnlichen Fall die 2.
Person. Allein da ist kein Misverstand möglich. Es fragt sich also nur, ob, wo
Misverstand denkbar ist, der Sprachgebrauch dies Pronomen beständig auf die redende, oder auf die angeredete Person
bezieht, oder ob er wechselt. Hierauf müßte man Acht geben. Natürlicher u. nach
allgemeiner Logik richtiger bleibt immer das Erste, u. darum würde ich es auch
im zweifelhaften Fall annehmen. Doch kann sich auch der Redende in die Stelle
der angeredeten Person versetzen. In der besondren Stelle nun scheinen mir für
Bopps Erklärung
folgende Gründe zu sprechen: 1., die Beziehung von
{svāni} auf die Schlange, als redende Person, ist immer die
natürlichere. 2., es scheint mir auch kein triftiger Grund da, von ihr
abzugehen. Die Schlangen haben zwar keine Füße. Allein dies ist eine Schlange
besondrer Art. Dies sagt sie selbst sl. 8. a. In sl. 4. a. ist sogar von |3*| ihren Händen die Rede, u. wenn man auch
dies metaphorisch nehmen kann, so möchte dies doch sl.
7. a. nicht füglich angehen, wo sie ausdrücklich sagt,
daß sie keinen Fuß vor den andern setzen kann. Hier hilft es auch nichts, an
Schritte zu denken; denn Schlangen schreiten auch nicht. Sl. 13. nimmt die Schlange gar Nalus Gestalt
an. Denn Sie meynen doch auch, daß
{sva}
dort sich mit
{ātmānaṃ} in der Zeile
vorher nur auf die nemliche Person beziehen kann? 3., scheint mir das Zählen der
Füße sogar hier passender, als der Schritte. Sie gehen in der Luft u. erheben
sich sogar, da ist eigentlich nicht von Schritten die Rede, heißt aber
{pada} auch wirklich
Schritt?
Wilson sagt nur
footstep
, wovon in der
Luft noch weniger die Rede ist. Auf
{gaccha} sl. 11. a.
kann man kein besondres Gewicht legen, als zeigte es bestimmt: gehen, schreiten
an. Es steht auch sl. 8. wo doch unfehlbar vom Erheben
die Rede ist. 4., Die ganze Stelle vom Carcotacas[a] hat mir immer sehr sonderbar geschienen. Sie bezieht
sich auf die Erzählung der Verzauberung des Carcotacas
durch Narada; ich weiß nun nicht, ob sich
diese in schon herausgegebnen Gedichten befindlich ist. Allein solange sie
unbekannt ist, scheint es mir noch bedenklicher, von der ganz wörtlichen
Erklärung der Stelle abzugehen. Wüßten wir, welche Bewandniß es mit jener
Verzauberung gehabt hätte, so würden vielleicht die Füße, trotz der
Schlangennatur, ganz natürlich, ja vielleicht nothwendig erscheinen.
Daß Sie recht bald etwas über die Unentbehrlichkeit des Sanskrits bei Untersuchungen, die über Homer hinausgehn sollen, u. über die gänzliche Unzuläßlichkeit alles Etymologisirens im Griechischen u. Lateinischen, ohne die Kenntniß des AltIndischen, sagten, wünsche ich ungemein, u. wollen Sie mich dabei citiren, so soll es mich sehr freuen. Es ist wirklich Zeit diesem etymologisirenden, rathenden u. im Blinden tappenden Unfug ein Ende zu machen. Ich habe noch neulich, in einem Briefe an Welcker, dem guten Schwenck, u. seiner Behauptung, daß die Götternamen alle nur aus der Griechischen Sprache zu etymologisiren sind, Ihre Ableitung des |4*| Vulcan, wie ein Medusenhaupt, entgegen gehalten. Sie ist schlagend, u. wirklich vortreflich. Ist Ihnen denn wohl das Unternehmen des HE. Kuithan[b] bekannt, dem ὂχ ἄριστος der hocherste ganz geradezu ist? Er wollte mir die Ehre erzeigen, mich sogar an die Spitze zu stellen. Ich habe ihm aber meinen ordentlichen Abscheu vor solchen Ableitungen zu erkennen gegeben.
Dem Text des
Bhagavad Gita werde
ich mit Vergnügen entgegensehen, u.[c] nicht aus der Hand geben. Ich dächte aber
gehört zu haben, daß er schon hier auf der öffentlichen
Bibliothek sey. Er mag also wohl auch schon ausgegeben worden
seyn. Die Uebersetzung richten Sie doch ja so wörtlich, als möglich, ein, u.
seyn Sie nicht zu besorgt wegen des Lateinischen. Das Indische ist hier die
Hauptsache. Ich weiß, was ich dem
Nalas, gegen dessen Latein sich allerdings viel sagen läßt,
verdanke. Ich habe schlechterdings aus ihm Sanskrit
gelernt. Denn ich habe, bis ich ihn ganz durchgelesen hatte, gar keinen
mündlichen Unterricht gehabt. Wollten Sie nicht auch ein kleines Wortregister u.
eins der Grammatikalischen Merkwürdigkeiten damit verbinden? In das erstere
würde ich nur die Wörter aufnehmen, die, dem großen Wörterbuch nach, so
vielfacher Bedeutung sind, vorzüglich aber die mit Ver Praepositionen verbundenen Verba, wo sie die Wurzelbedeutung ändern. Dies ist eine
sehr ernsthafte Schwierigkeit beim Lesen. Sie können sagen, daß die Uebersetzung
das Register unnütz macht. Allein dies ist doch nicht der Fall. Man vergleicht
gern die verschiednen Stellen, wo ein Wort vorkommt. Ohne solche Register bei
einzelnen Ausgaben ist das künftige Zusammentragen eines ordentlichen
Wörterbuchs kaum möglich. Die Mühe aber würde für Sie sehr klein seyn, da das
Ordnen ins Alphabet füglich ein andrer machen kann. In dem Grammatischen
Register würde ich die seltnen Formen: 3. praet. precat.
infin. pass. u. s. f. dann die Abweichungen von der gewöhnlichen
Bedeutung der casus oder den gewöhnlichen grammatischen
Regeln, den Gebrauch des {sva} u. solche
Einzelheiten erwarten. Es kostet gar keine Mühe, bei der Bearbeitung so etwas
zugleich an-|5*|zumerken, und gewährt, wenn man die einzelnen Fälle
zusammen übersehen kann, großen Nutzen, ja manchmal ganz neue Ansichten.
Die Einleitung, von der ich sprach, ist wirklich nur vor der 1. Aufl. der Grimmischen Grammatik, allein ich empfehle sie Ew. Hochwohlgebohrnen. Ich kenne vielleicht nichts so Geistvolles, was allgemein über Sprache geschrieben ist. Die Flexionen des Deutschen Sprachstammes so viele Jahrhunderte hindurch zu verfolgen, ist allerdings ungemein wichtig. Allein die Folgerung, die Sie aus dieser Erscheinung zu ziehen scheinen, möchte ich nicht ganz zugeben. Es scheint mir daraus noch gar nicht zu folgen, daß der Flexionszustand der ursprüngliche war. Darin bin ich noch voller Zweifel. Sie reden von „Flexionssprachen“ für mich aber bedarf es noch einer ganz neuen, u. viel tiefern Untersuchung, als man bisher angestellt hat, ehe ich wagen würde, einen solchen Ausdruck zu brauchen. Mein jetziges Glaubensbekenntniß darüber ist dies. In den Sprachen, wie wir sie jetzt kennen, liegt kein solcher Unterschied, daß in einer gar keine Agglutination, in einer gar keine Flexion wäre. In der rohesten Amerikanischen Sprache finden sich, u. gar nicht einzeln, sondern in bedeutender Zahl, Fälle, die man mit eben dem Recht für Flexion halten muß, als z. B. die Verbal Endungen des Indischen. Wo nun jetzt Agglutination ist, hätte sie in Flexion übergehen können, wo diese jetzt ist, kann sie Agglutination gewesen seyn. Ich bin aber ganz überzeugt, daß sich dies nicht historisch ausmachen läßt, d. h. daß sich nicht überzeugend nachweisen läßt, daß die Flexionen, auch nur zum größten Theil, anfangs agglutinirt waren. Dagegen <Indeß> erhebt man dagegen auch bisweilen Argumente, die mich nicht überzeugen. So schrieben mir Ew. Hochwohlgeb. einmal, die Verbal Endungen könnten nicht Pronomina seyn, da sich das Pronomen am spätesten ausbilde. In unsrer Theorie, selbst bei Bernhardi, erinnere ich mich auch solche Dinge über die successive Entstehung der Redetheile gl gelesen zu haben. Ich glaube aber daran nicht. Die Grammatik entsteht allerdings successiv, eine vollkommnere, nach einer unvollkommneren, allein sie ist immer ganz, es folgt nicht ein |6*| Redetheil nach dem andren. Das widerspricht aller Ansicht, die ich von der Sprache überhaupt habe. Man hat, als Beispiele, schwerlich mehr ursprüngliche Sprachen, als die Amerikanischen, u. in allen spielt das Pronomen die Hauptrolle, u. die Entstehung des Verbum durch dasselbe ist darin klar u. unbestreitbar. Dennoch kann, dünkt mich, jene Frage, ob irgend eine Sprache, ohne <mit> Flexion, angefangen hat? nur nach allgemeinem Raisonnement entschieden werden. Da kann ich nun zuerst in die Idee Ihres Herrn Bruders von Völkern, die gleichsam mit über- oder wenigstens mit hochmenschlichen, nicht bloß Fähigkeiten, sondern Erzeugnissen derselben, wie Sprachen sind, aufgetreten sind, nicht eingehen. Sie schneidet, wie jede andre Verkündigung von einem Wunder, alle wissenschaftliche Untersuchung ab, ist aber selbst nur ein Postulat der Vernunft. Es scheint mir damit zu seyn, wie mit Creuzers Ausgehen von dem Glauben an Einen Gott. Mir scheint es vielmehr natürlich, daß es zuerst in der Sprache (nicht in dem Kopf der Redenden, wo sie immer auf irgend eine Weise seyn muß) keine Grammatik gab, d. h. keine, in sich bedeutungslosen Zeichen für das grammatisch Formelle. Lauter Wörter mit materieller Bedeutung standen neben einander, wie in der Schriftsprache der Chinesen. Daraus wurden, der Regel nach, die meisten nachherigen Flexionen. In dem Uebergange zu diesen liegen alle mir bekannte Amerikanische Sprachen mit verschiednen Fortschritten zu diesem Ziele. Indeß gebe ich zwei Ausnahmen zu, u. darin möchte meine Meynung sich von der bisher darüber gehegten unterscheiden. 1. Ich glaube allerdings, daß es einzeln auch ganz ursprüngliche Flexionen geben kann, d. h. in Fällen, wo ein einzelner Buchstabe, ein Accent, der natürlichen Vorstellung nach, einer grammatischen Form so entspricht, daß auch die roheste Phantasie die Analogie leicht auffindet. Als Beispiel lassen Sie mich anführen, daß in einigen Amerikanischen Sprachen die länger vergangene Zeit mit einer Pause gegen die kürzer verflossene ausgesprochen wird, daß noch heute im Englischen, wo Verbum u. Subst. gleichlautend sind, das immer seinem Régime zueilende Verbum den Accent auf die letzte, das Subst. auf die vorletzte Silbe setzt, présent presént. |7*| Denn die Schwierigkeit, mit der Phantasie passende Analogieen zwischen den grammatischen Begriffen u. ihren Lautzeichen zu finden, ist es vorzüglich, die mich gegen das System ursprünglicher Flexionen einnimmt. Wenn z. B. der Begriff des Locativus auszudrücken ist, so giebt es dazu zwei Wege: man erfindet einen Laut zum Ausdruck dieses Begriffs (ursprüngliche Flexion) oder man symbolisirt den Begriff, der formell ist, in einen Gegenstand, u. braucht das Zeichen dieses Gegenstandes z. B. Feld Ort für campo (Ursprung durch Agglutination) Solange man nun, was ich immer wiederholen muß, nicht durch Wunder, sondern menschlich u. geschichtlich erklären will, ist im Allgemeinen für mich die letztere beider Erklärungen allein annehmbar. Zwischen Gegenstandswörtern u. den Lautzeichen ist immer eine Phantasiebeziehung zu finden, auch sind die Gegenstände (d. h. die ursprünglich zu bezeichnenden) unmittelbar u. mittelbar unter den Sinnen u. zeigbar, wie aber steht es da mit den grammatischen Begriffen? 2., Nun aber glaube ich gar nicht, daß der Uebergang zu Flexionen überall auf gleiche Weise, u. noch weniger, daß er überall nur durch die Zeit geschehen ist, daß die vollkommne Sprache nur eine jüngere ist. Das wäre eine schreckliche Idee. Die Güte einer Sprache in ihrer Bildung hängt von der Güte der Nation ab, die sie spricht, u. da kommt es bloß auf zwei Dinge an, auf die Lust am vielen u. wohltönenden Sprechen (woher ich vorzüglich die Treflichkeit des Griechischen ableite) u. auf die Fähigkeit u. Neigung zum formellen Denken. Dazu braucht eine Nation gar nicht philosophisch gestimmt zu seyn, sie braucht nur Lust an Tönen, u. an witzigen, lieblichen, oder spielenden Gedanken zu finden, was sich beides in der Poesie vereinigt. Ist nun eine Nation so gestimmt, so verliert das Grammatische bald seine Materie, oder vielmehr es hört das Aneinanderreihen von Wörtern, die man sich alle, als Gegenstände denkt, auf, u. es kommt die Grammatik, die bisher nur in den Köpfen war, steigt in die Sprache hinab. Eine solche Nation macht also den Uebergang zu Flexionen schneller. Aber das ist bei weitem nicht Alles. Sind einmal auf diesem Wege Flexionen entstanden, u. als solche gebraucht worden, so ist eine Analogie da, an der man weiter fortgehn kann, u. so können nun aus den vorhandnen Flexio-|8*|nen neue u. mehr, als wirklich ursprüngliche Flexionen, da ja ohne materielle Bedeutung entstehen. Ob man hiervon wird Beispiele angeben können, ist mir sehr zweifelhaft. Aber die Sache scheint mir evident, u. schon die bloße Möglichkeit muß das Bestreben, alle Flexionen einer Sprache auflösen zu wollen, bedenklich machen. Ueber dies Bestreben ist meine Meynung, daß es zwar sehr heilsam ist, u. daß man überall versuchen muß, wo man analysiren u. den A einen Agglutinationsursprung auffinden kann, daß man aber nur dasjenige für wirklich analysirt halten muß, was wahre Evidenz mit sich führt. In allen Sprachen nehme ich einen Punkt an, wo die Organisation vollendet ist, u. das Grammatische nun nicht mehr wesentliche Aenderungen erfährt. Bis zu diesem Punkt giebt es meiner Meynung nach ein Aufsteigen von der Agglutination zur Flexion. In diese Periode setze ich die Amerikanischen Sprachen, <Sprachen.> Erleiden aber diese Sprachen weiter Veränderungen, Uebergänge in Abarten, so entsteht nun ein Herabsteigen von der Flexion, jedoch nicht zur Agglutination, sondern zur scheinbaren Entbehrung der grammatischen Form. In diese Periode fällt nun die Geschichte des Deutschen Sprachstamms. Daß die sichtbar agglutinirenden Sprachen zu den frühen gehören, ist, dünkt mich, klar. Ob aber das Verschmähen der Grammatik der Chinesischen nicht vielleicht einem alternden über alle Casus u. Verbal Endungen Blazirtseyn zuzuschreiben ist, möchte ich nicht entscheiden.
Was Ihr Herr Bruder sich in seinem sonst sehr geistreichen Werk über Indien unter dem Entfalten der Wortformen aus ihren Wurzeln gedacht hat, das er dem Agglutiniren[d] entgegenstellt, habe ich mir nie vollkommen deutlich machen können. Die meisten Wortformen bestehen im Sanskrit gegen ihre Wurzeln durch Zusätze, was schon die Kürze der Wurzeln, gegen sie genommen, beweist. Hat er die Vocalveränderungen gemeynt, so bestimmen sie selten einzelne Wortformen, sondern begleiten immer ganze Classen von Flexionen. Dies ist, was ich jetzt über diesen Punkt meyne. Ich will aber meine Untersuchungen fortsetzen, u. denke meine Ansicht erst in meiner Darstellung der Amerikanischen Sprachen vollständig zu entwickeln. – Ich bin so ausführlich geworden, daß ich nun auch schlechterdings keinen neuen Bogen anfangen will,
u. bitte Sie, die Versichrung meiner herzlichsten u. hochachtungsvollsten Freundschaft anzunehmen.H
Fußnoten
- a |Editor| Leitzmann S. 112 schreibt – wie Bopp im Nalas XIV 10. 13 – Carcocacus.
- b |Editor| Johann Wilhelm Kuithan (1760–1831), Leiter des Archigymnasiums in Dortmund und Schulreformer. Kuithan vertrat die Ansicht, das westfälische Platt sei eine vorhomerische Sprache und Deutsch und Griechisch seien lexikalisch identisch.
- c |Editor| Leitzmann S. 113 für ein: [ihn].
- d |Editor| Leitzmann S. 199: der Agglutination.