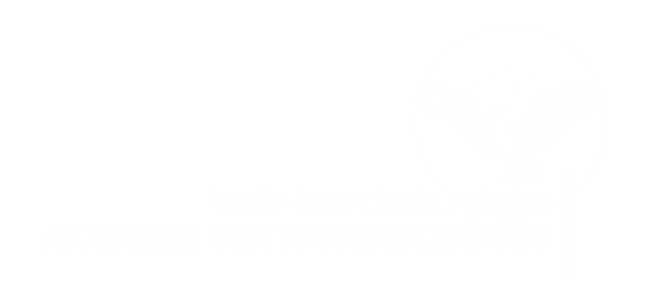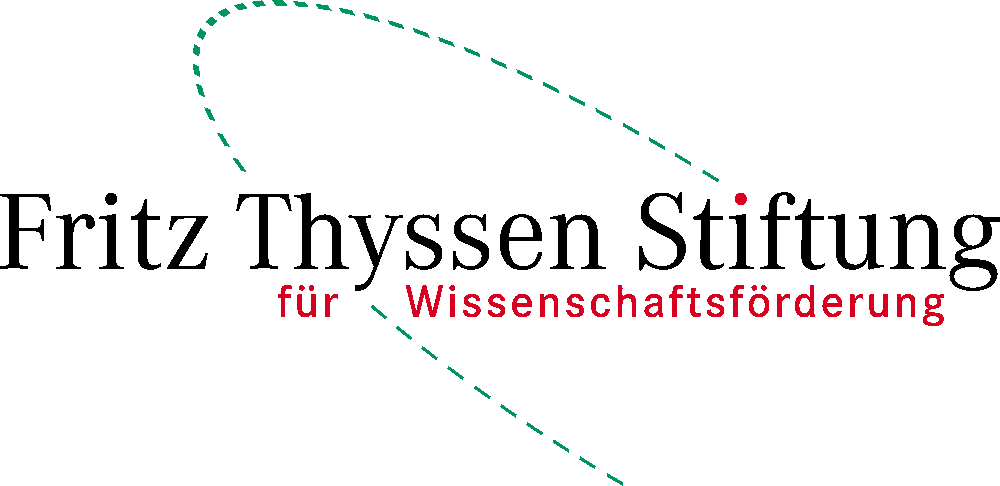Wilhelm von Humboldt an August Wilhelm von Schlegel, 21.06.1823
|1*|[a] Ottmachau, den 21. Junius, 1823.Ich erhielt E. Hochwohlgebornen gütige Zeilen vom 19. v. M. (die aber wohl
später abgegangen seyn müssen) so kurz vor meiner Abreise hierher, daß es mir
unmöglich war, sie noch von
Berlin aus zu beantworten. Jetzt ist es mir um so
lieber, die Antwort verschoben zu haben, da ich Ihnen sagen kann, daß ich die
ersten 10. Gesänge des
Gita
gelesen habe. Bemerkungen, die Sie interessiren könnten, werden Sie von mir, und
am wenigsten nach der Lesung des bloßen Abdrucks schon selbst nicht erwarten.
Aber danken thue ich Ihnen recht herzlich für die große Freude, die mir das
Lesen schon dieses Theils des Gedichts gewährt hat. Es ist mir in solchen Dingen
eine gewisse Kindlichkeit geblieben, und ich kann nicht abläugnen, daß mich
während dieses Lesens ein paarmal das Gefühl einer wahren Dankbarkeit gegen das
Schicksal
überrascht, das
mir <überrascht> hat, das mir vergönnt hat,
diese Dichtung so gut, wie es mir nun jetzt eben damit geht, in der Ursprache zu
vernehmen. Es ist mir, als würde mir etwas recht Wesentliches gefehlt haben
würde, wenn ich, ohne das, hätte die Erde verlassen müssen. Man
kann nicht sagen, daß man gerade dadurch neue Wahrheiten entdeckt. Der
unbeschreiblich fesselnde Reiz liegt nicht einmal in der Bestätigung längst
erkannter. Aber man wird von einem so wundervollen Gefühle alterthümlicher,
großartiger und tiefsinniger Menschheit ergriffen, daß man wie in
einem <Einem>
Punkt die geistige
Entwickelung aller Menschengeschlechter und ihre Verwandtschaft mit dem Reiche
alles Unsichtbaren zu empfinden glaubt. Die Sprache erscheint ganz anders in
diesen Ueberbleibseln der ältesten Zeit. Der Gedanke scheint inniger mit den
Worten verschmolzen, und in dem Laute, der Bewegung dieser, ihren Anklängen an
verwandte Begriffe u. Bilder fühlt man immer mehr, als den einzelnen Gedanken,
ja selbst als ein Individuum, wirklich das geistige Walten eines ganzen
Zeitalters. Nichts was ich bisher im Sanskrit gelesen, hat mir einen solchen
Eindruck hinterlassen, ich begreife indeß, daß wer das Stück nur in der
Uebersetzung, und sey es auch die beste, liest, das gar nicht empfinden kann.
Die Uebersetzung s eines solchen Werks gleicht
wirklich der Beschreibung eines Gemäldes. Farben u. Licht fehlen. Ich werde
gewiß, wenn ich mit dem Ueberrest des Gedichts fertig bin, es oft wiederlesen,
wie ich mich nicht habe enthalten können, schon mit den ersten Gesängen zu thun.
Die ersten |2*| drei Gesänge las ich ohne
Wilkins Uebersetzung, die ich erst später erhielt, aber nun hier habe.
Grammatische Schwierigkeiten bietet dies Gedicht vielleicht weniger dar, als
Alles, was ich bisher versucht habe. Die Construction ist von der höchsten
Einfachheit. Indeß bin ich überzeugt, daß Ihre
Bearbeitung schon sehr viele Schwierigkeiten weggenommen, u. habe
die Leichtigkeit, mit der man, ohne durch Fehler aufgehalten zu werden,
fortliest, dankbar empfunden. Ich habe auch die geringe Anzahl der Druckfehler
bewundert. Es ist mir keiner, außer den angeführten, aufgestoßen. Zwar ist mir
lect. 4. sl. 1. v. 2. {ikṣvakave} mit der kurzen zweiten Silbe aufgefallen, da ich immer sonst
{ikṣvāku} finde. Allein
es giebt doch wohl zwei Formen, oder hier einen mir unbekannten, den Vocal verlängernden Grund. Die Lettern haben mir erst
jetzt, wo ich sie zusammen sehe, ganz so gefallen, wie sie es verdienen. Ich
räume ihnen nun durchaus den Vorzug vor denen von
Wilkins ein. Nur ein Paar wünschte ich
anders. So das
{dra}, das man zu
leicht mit
{dga} (dg) verwechslen kann, nicht zwar wenn sie bei einander
stehen, aber wenn man jenes allein sieht. So auch scheint mir
Wilkins κτν
deutlicher. In Ihrem Zuge kann man einen Augenblick anstehen, ob das κ oder τ
der erste Buchstabe seyn sollen. Dagegen sind alle andren Züge so deutlich u.
bestimmt unterschieden, u. so zierlich gewandt, auch in so richtige Entfernung
gebracht, daß die Leichtigkeit des Lesens dadurch ungemein gewinnt. Wenn die
Asiatische Gesellschaft
in
Paris einmal
Lettern gießen läßt, thäte sie sehr gut, ganz die Ihrigen zu nehmen. – Für die
Abdrücke meiner Abhandlung sage ich Ihnen meinen
herzlichsten Dank. Ich bitte Sie aber sehr, meinetwegen ja nicht mit dem Druck
des folgenden Heftes zu eilen. Mein
Aufsatz ist so wichtig nicht, daß nicht recht füglich die
Fortsetzung noch ausbleiben könnte, und ich bin gar nicht sehr überhaupt auf das
Drucken gerichtet. Es thut mir vielmehr immer leid, daß etwas nun so fest und
starr da steht, daß sich nichts mehr daran ändern läßt. – E. Hochwohlgebornen
Reise nach
London
halte ich für das Sanskritstudium von großer
Wichtigkeit. Sie werden dort den Eifer anzuregen, u. guten Rath zu ertheilen
wissen. Aeußerst wichtig wäre ein raisonnirendes Verzeichniß der Sanskrit Handschriften in der Sammlung
der Britischen
B <des> Ostindischen
Hauses, wo möglich so ausführlich gemacht, als
Casiris Beschreibung der Arabischen des Escurials. So Vieles auch einzeln darüber in den
Asiatischen Untersuchungen u. sonst
vorkommt, so übersieht man doch bei weitem noch nicht genug den ganzen Umfang
der Indischen Literatur, u. trostlos ist es gar, |3*| wenn man nichts
als Namen u. Titel hört. So möchte ich so gern wissen, ob es wirklich eine
höhere, wissenschaftliche oder wenn Sie wollen, richtiger beredte Prosa, der
Griechischen ähnlich, in der Sprache giebt, u. wenn eine solche vorhanden ist,
eine Probe davon sehen. Gesetzbücher, Grammatiken, Commentare, streng
wissenschaftliche Werke rechne ich natürlich nicht dahin. Die Philosophen
scheinen großentheils zugleich metrisch zu seyn. Ob es aber prosaisch
philosophische Werke giebt? ob historische, die man gemeinhin abläugnet, von
denen ich aber doch Einiges erwähnt gefunden habe? ob sonst prosaische Werke, in
denen die Form, der Stil, wenigstens zugleich für sich eine Rolle spielt? möchte
ich wissen. Es gab doch auch in Indien Republiken. Sollte die Beredsamkeit in
einer solchen Sprache gar keinen Platz gefunden haben? Es ist wunderbar, daß
man, soviel auch über gewisse Gegenstände geschrieben ist, doch nicht
Aufschlüsse über manche höchst wichtige u. ganz einfache Fragen erhält. So habe
ich aus
Remusats
ganzer Schrift über die Chinesische Literatur nicht
herausbringen können, ob es in derselben große Epische Gedichte giebt, oder
nicht? Unendlich gern hätte ich aus
London den
Amara
Cosha, den zweiten Theil des
Ramayana (beide sehr schwer zu finden) u.
das Gesetzbuch des Manus. Sie
erzeigten mir eine große Gefälligkeit, wenn Sie mir sie verschaffen
könnten.[b] Die
Auslagen erstatte ich sogleich. –
Ritters liegende Bildsäulen sind freilich schrecklich.
Ich habe die Vorhalle nur zum Theil u. nur flüchtig
gelesen, bin aber selbst ein wenig an dem Buche Schuld. Er fing es 1816. in
Frankfurt zu schreiben an, u. theilte mir den Anfang mit.
Ich war damals noch weniger bewandert, als jetzt, in diesen Dingen, einige Ideen
frappirten mich, u. da man ihn hätte anhalten sollen, ermunterte ich ihn. Er war
wirklich selbst augenblicklich in seinem begeisterten Tone, wie Sie es mit Recht
nennen, zweifelhaft u. merkte selbst Unrath. Jetzt glaube ich, sieht er es noch
mehr ein. Da er so viel wahres Verdienst hat, glaube ich, thut man am besten,
die Schrift ganz ungedruckt anzusehen, u. sich nur an das zu halten, was er
davon wieder einmal vorbringen könnte. Sprachkunde schien er mir immer nicht
viel zu besitzen. Allein man sollte sich dann an bewährte Uebersetzungen halten,
da man allerdings nicht Alles wissen kann. –
Prichard hat seine Widder-Geißelung[c] wohl nicht einmal aus dem Original
gewonnen[d], sondern aus
Vallas lat. Uebersetzung, wo, wie ich mich, da mich
ehemals die Stelle auch in Verlegenheit setzte, erinnere, derselbe Irrthum
ist.[e]
Riemer – das einzige Griechische
Wörterbuch, das ich hier habe, weil es zufällig hier liegen geblieben ist, –
sieht κόπτεσθαι φ*ναγα mit dem
Accusativ für die gewöhnliche Construction an. Aber ich müßte mich sehr irren, wenn der spätere mehr
<logisch> gebildete Graecismus dies |4*| erlaubt hätte. Man sagte, wenn ich mich recht erinnere, das Wort
mit dem Dativ, was auch natürlich ist: sich für einen an
die Brust schlagen. Der Accusativ bei
Herodot ist eine Anomalie. Da ich leider wenig von dem lese, was seit den
letzten Jahren erschienen ist, so ist mir der Unfug, von dem Sie reden, weniger
bekannt. Es ist aber kaum der Mühe werth, ihn großer Aufmerksamkeit zu würdigen,
u. man thut wohl am bess besten, nur, gel wo es die Gelegenheit giebt, solche Verstoße zu
rügen. – Wegen des Arabischen haben Ew. Hochwohlgebornen eigentlich wohl recht,
daß es nicht gut ist, sich zu sehr zu verbreiten. Aber mein Weg führt mich
einmal dahin, mich mit der Sprache überhaupt zu beschäftigen, u. da darf man
eigentlich keinen der Hauptstämme vernachlässigen. Eine natürliche Folge davon
aber ist freilich, daß man in jeder einzelnen Sprache gegen andre zurücksteht.
Nur mache ich doch sorgfältige Unterschiede. Es ist gar nicht meine Absicht,
eigentlich in die Arabische Literatur einzugehen, ich suche nur insofern zu
verstehen, als man ohne das doch keinen anschaulichen Begriff von der Grammatik
haben kann. Diese ist aber im Arabischen sehr merkwürdig, wenn man auch nur die
fast gänzliche Gleichgültigkeit der Vocale, wenigstens bei den Wurzeln, den
bestimmten Unterschied zwischen den Wurzelbuchstaben u. einigen wenigen,
ausschließend zu den Beugungen gebrauchten, u. das Einschieben von
Beugungslauten zwischen die Wurzelbuchstaben nimmt. In ihrem Wesentlichen ist
die Arabische Grammatik überaus leicht, viele der kleinlichen Mühseligkeiten,
mit denen man zu kämpfen hat, gehören nur den Grammatikern an. Für das Persische
muß es aber doch anziehend seyn, beides Arabisch u. Sanskrit zu kennen. Es ist
gewissermaßen für die Orientalischen Sprachen, was das Englische in den
Abendländischen. – Nun leben Sie herzlich wohl, u. vollenden Sie Ihre Reise
glücklich. Erhalten Sie mir Ihr gütiges u. wohlwollendes Andenken, u. wenn Sie
mich in den nächsten beiden Monaten mit einem Briefe erfreuen wollen, so lassen
Sie ihn doch, ungeachtet meiner Abwesenheit nach
Berlin gehen. Ich bekomme ihn auf diese
Weise sichrer.
H.
Fußnoten
- a |Editor| Anmerkung Schlegels oben links: Beantwortet d. 7ten Jul.
- b |Editor| Der Amarakosha befand sich in Humboldts nachgelassener Bibliothek (s. Schwarz 1993, S. 35 Nr. 236), während der zweite Band des Ramayana der Ausgabe von Carey und Marshman fehlt (s. Schwarz 1993, S. 36 Nr. 244); Manus Gesetzbuch findet sich in der Ausgabe Haughtons von 1825 (Schwarz 1993, S. 36 Nr. 245).
- c |Editor| Siehe James Cowles Prichard: An Analysis of the Egyptian Mythology (London, Cornhill: John and Arthur Arch 1819) S. 367.
- d |Editor| Leitzmann S. 162: genommen.
- e |Editor| Siehe Lorenzo Valla: Herodoti Halicarnassei Historiarum libri IX, IX musarum nominibus inscripsi … (Frankfurt/M.: Apud Claud. Marnium, & hered. Jo. Aubrii 1608) S. 106: "arietem verberant".