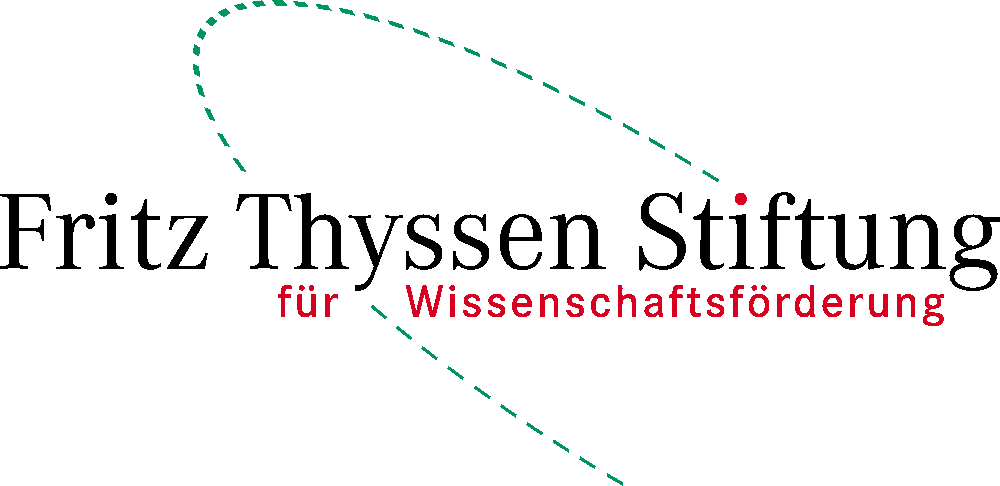Wilhelm von Humboldt an August Wilhelm von Schlegel, 05.03.1826
|1*|[a] Ew. Hochwohlgebornen gütiger und freundschaftlicher Brief hat mir eine ungemein große Freude gemacht, und ich statte Ihnen meinen herzlichsten Dank dafür ab. Ich bitte Sie aber sehr auf keine Weise zu glauben, daß ich nur einen Augenblick hätte über Ihr Stillschweigen können empfindlich seyn. Es würde mich ängstigen und vom eigenen Schreiben abhalten, wenn ich mir dächte, daß Sie Sich in einer Art moralischer Verbindlichkeit hielten, um einer Antwort willen von andren Beschäftigungen abzugehen, u. ich bitte Sie recht herzlich auch künftig vollkommene Freiheit darin zu beobachten.
Ich hatte überdies in der Zwischenzeit Ihre lateinischen Schriften empfangen, und wirklich bewundert. Es ist eine beneidenswürdige Gabe, in jeder Sprache eines reinen, würdigen, reichen u. zierlichen Ausdrucks mächtig zu seyn, und eine um so edlere Gabe, als sie nicht durch Studium u. Uebung erworben wird. Sie setzt etwas in dem Geiste voraus, das der verschiedenartigen Natur des nationalen Gedankenausdrucks in der Auffassung einer darin liegenden Allgemeinheit entspricht, eine Kraft die innere Eigenthümlichkeit mitten in dem gewandten Anschmiegen an fremde Formen festzuhalten. Am meisten muß ich gestehen, hat mich das Gedicht in beiden Sprachen[b] gefreut. Es ist in jeder Rücksicht vortreflich, und es lebt gewiß niemand, dem es auf diese Weise gelungen wäre. In dem Briefe an Blumenbach[c] hätte ich gewünscht, daß Ew. |sic| noch mehr versucht hätten, naturhistorisch philosophische Ideen wenn nicht auszuführen, doch anzuspielen. Niemand ist so sehr, als Sie, im Stande, eine alte Sprache mit dem Ausdruck neuer Ideen glücklich ringen zu lassen, und ein solcher Kampf der Sprache mit dem Begriff ist immer ein höchst anziehendes *** Schauspiel.
Es ist mir sehr schmeichelhaft, daß Ew. Hochwohlgebornen |2*| meinen Bemerkungen einen Platz in Ihrer Bibliothek gönnen wollen. Ich bin auch ganz der Meinung, daß Langlois Stellen mit abgedruckt werden müssen, u. habe nichts dagegen, wenn Ew. Hochwohlgebornen neben meinen ruhigen und milden Bemerkungen (wie Sie dieselben nennen) ein schärferes Gericht halten. Mir kam kein andrer Ton zu, da Langlois doch am Ende leicht noch mehr Sanskrit weiß, als ich. Mit Ew. Hochwohlgebornen ist es anders. Wenn Sie mir aber erlauben, Ihnen offen meine Meinung zu sagen, so würde ich auch in Ihrer Stelle diesmal auf den Spott u. selbst das Spötteln verzichteten <verzichten> , und einen ernsten Ton <annehmen>, in dem Sie aber deutlich äußerten, daß das Chezysche Betragen, sowie Colebrooke es sehr gut in seinem Briefe sagt, dem wahren Geist ächter Wissenschaft u. Wahrheitsliebe durchaus widerspricht.[d] Ich glaube, das wird in Frankreich viel mehr Eindruck machen, u. den Gegner ganz in sein Unrecht stellen, da bei einer ironischen Behandlung doch immer eher der Bespöttelte in Schutz genommen wird, u. man doch vielleicht in der Ironie die Verletzung einer gewissen Pietät gefunden werden könnte. Denn weil nun einmal Chezy früher Sanskrit gewußt hat, als Sie Sich damit beschäftigten, so fehlen doch die Anwendungen der Begriffe von Lehrern u. Schülern nicht, so thöricht ich sie auch halte, da z. B. weder Bopp noch Sie, soviel mehr Sie beide doch hier ein Recht dazu hätten, mich haben dies Lehrerverhältniß fühlen lassen. Chezy arbeitet selbst nichts für das Publikum, aber ärgert sich, wenn andre es thun. Das ist die ganze kleinliche Erbärmlichkeit. Das fühlt man aber gewiß auch in Paris, wie bei uns. Ich finde es sehr natürlich, daß Sie Ihre Antikritik französisch schreiben. Ich habe aber noch keinen rechten Begriff, wie Ew. Hochwohlgebornen nun das Ganze einrichten, u. auch meinen Bemerkungen einen Platz vergönnen wollen. Vermuthlich u. das schiene auch mir, wenn ich mir ein Urtheil erlauben darf, das Angemessenste, trennen Sie |3*| Ihre französische Schrift von der Bibliothek, geben aber den wesentlichen Inhalt, vorzüglich das, was die Interpretation der einzelnen Stellen betrift, in der Bibliothek in andrer Form. Den Wunsch, daß, wenn Ew. Hochwohlgebornen noch Gebrauch von meinen Bemerkungen zu machen die Güte hätten, diese doch spätestens zu Michaelis dieses Jahres erschienen, werden Sie verzeihlich finden. Auf Ihre berichtigenden Anmerkungen freue ich mich sehr, und danke Ihnen herzlich dafür, daß Sie mir durch einiges früher Mitgetheilte Gelegenheit geben, schon jetzt einiges auszumärzen, und unnütze vermuthende Erklärungen abzuschneiden. Ich antworte auf diese Stellen auf einem eignen Blatt.
Daß es ursprünglich metaphysische Ausdrücke geben kann, möchte ich auf keine
Weise bestreiten. Was Ew. Hochwohlgebornen über {deha} in dieser Beziehung sagen ist nicht nur höchst scharfsinnig,
sondern auch so ansprechend, daß man auf den ersten Anblick gleich es für wahr
zu halten geneigt ist. Andre Begriffe sind aber wohl offenbar erst nach u. nach
übergetragene[e], und dahin möchte
{yoga}
gehören. Das aber dürfte doch wohl immer wahr bleiben, was ich in meinen
Bemerkungen sage, daß auch den ursprünglichst metaphysischen Begriffen eine
sinnliche Anschauung zum Grunde liegt. Auch in dem von Ihnen angeführten
Beispiel ist es nicht anders. Allein in Sprachen, wo die Speculation schon seit
sehr frühen Zeiten gewaltet hat, ist dies bei weitem nicht immer nachzuweisen.
Die Idee der drei Sprachgattungen sollten Sie doch einmal ausführen. Ich bin bis
auf einen gewissen Grad über das Wirken der Urvölker auf die Sprachen ganz Ihrer
Meinung, ich unterscheide ebenso Natur u. Erfahrung, glaube an das
Divinatorische der noch kräftigen Natur, halte dafür, daß Vieles in den Sprachen
kann durch einen glücklichen Wurf entstanden seyn, nehme auch ursprüngliche
Flexion an; indeß halte ich mich immer innerhalb dessen, was wir gewissermaßen
noch an Menschen sehen, oder wenigstens menschlich schließen können, u. lasse
diese Dinge, als durch nichts |4*| Factisches geradezu beweisbar (oder
besser insofern sie das nicht sind) als Möglichkeiten stehen, brauche sie nicht
sowohl direct, als nur um nicht, indem ich sie abläugnete, Schranken zu ziehen,
von denen die Wirklichkeit frei ist, u. welche die Untersuchung einengen. Nichts
ist mir so widrig, als bloß mechanische Erklärung. Dagegen gehen Sie, soviel ich
sehen kann, viel weiter, setzen Uebermenschliches, oder wenigstens Menschliches,
wovon wir nirgends ein Analogon ahnden können, voraus, scheinen das Mechanische,
auch wo es seyn kann u. ist, ganz verdrängen zu wollen, und sehen in einigen
Sprachen nur jenen kühnen freien Gang einer schöpferisch bildenden Kraft, indeß
sie |sic|[f] andre dem gebundnen u. mühseligen, der irdisch an einander
knüpft, hingeben. Der Hauptunterschied zwischen uns aber möchte wohl darin
liegen, daß ich furchtsamer historisch zu Werke gehe. Sie reden von den Urvätern
des Menschengeschlechts. Bis dahin scheint mir keine Sprache zu führen. Ich
befinde mich immer nur in einer Mitte der Bildung, wo von den Fortschritten mehr
oder weniger sichtbar, aber der Anfang ganz dunkel ist. Daher ist mir auch keine
Sprache rein, alle, die wir kennen, sind schon gemischt. Das Glück des
Organismus der sehr gelungenen scheint mir nun darin zu liegen, daß da, wo ihre
Eigenthümlichkeit aus schon vorhandnen Elementen entstand (denn einen
Concretions- oder Congelations- oder Krystallisationspunkt muß es für jede
Sprachindividualität geben) diese Sprachen glücklich u. rein organisirten
Stämmen unter günstigen Umständen angehörten. Neben diesen glücklichen
Ausnahmen, denn so kann man sie doch nennen, giebt es aber eine Anzahl weniger
gerathener Bildungen, u. da Vieles doch allen Menschen gemeinsam ist, Vieles
auch allen Völkern in den Lagen, wo die gesellschaftliche Verfassung noch auf
niedrigen Stufen steht, so bieten auch die glücklichst organisirten Sprachen
Unvollkommenheiten, u. die unvollkommenen einzeln[g] Erstaunen erregende Vorzüge
dar. Man muß nur viele einzelne Sprachen untersuchen, die Zergliederung recht
anstellen, überall das Gemeinsame sorgfältig vom Abweichenden u. Eigenthümlichen
abscheiden, und eine jede Sprache aus dem Gesichtspunkt betrachten, aus dem sie
der Nation |5*| erscheinen mußte, die sie sprach. Diesen Weg suche ich
zu gehen, und habe diese Methode noch neulich am Chinesischen versucht, das wohl
in grammatischer Hinsicht eine der aller merkwürdigsten Sprachen ist. Sie ist
der wahre entgegengesetzte Pol des Sanskrits, diese beiden Sprachen sind
gleichsam die vollkommne Grammatik u. die Grammatiklosigkeit. Zwischen beiden
liegen dann die zahllosen Mundarten mit unvollkommneren Grammatiken.
Es ist wohl sehr schwer zu sagen, ob die Anomalieen die spätern oder frühern Bildungen sind. Ich glaube beides, allgemein läßt sich darin nichts entscheiden. Ich weiß nicht ob Ew. Hochwohlgebornen Beckers Deutsche Wortbildung kennen. Es ist gewiß kein zu verschmähendes Buch. Er hält die Deutsche Abwandlung: binde, band, gebunden für die ältere, u. darin möchte ich ihm wohl beistimmen. Diese Vocalumlautung kann nur eine sehr frühe, gewissermaßen ursprüngliche seyn. Nachher können freilich einzelne Verba, die sie nicht hatten, so angeformt seyn. Daß die Gleichheit des Nominat. u. Accus. der Neutra eine Schönheit sey, möchte ich doch bezweifeln. Sie verschwindet, wenn ich auch alles Uebrige annehme, schon dadurch wenigstens im spätern Griechischen u. Lat. weil ja viele unbelebte Dinge Mascul. u. Fem. u. einige Neutra belebte sind. Sollte auch der Unterschied zwischen handeln und wirken so scharf aufgefaßt worden seyn? Was ich am meisten entgegensetzen möchte, ist, daß die ganze Sprache in ihrem tiefsten Wesen Eine große Prosopopöe ist, wo das logische Urtheil a = b verwandelt wird in ein Vorstellen, daß a handelt oder leidet u. in der einen oder andren Beziehung mit b steht. Gerade der frischere Mensch mit noch einzeln mehr verständlicher Sprache mußte das viel lebendiger fühlen, als wir, die wir schon soviel allgemeine Verben haben, die den Begriff dem = der Mathematik so nahe, als möglich, bringen. Ohne Rücksicht auf die Bedeutung mußte also Subject u. Object scharf geschieden da stehen. Die Homonymie der Neutra in diesem Fall scheint mir nur daher zu kommen, |6*| daß die Declination der Neutra überhaupt eine unvollkommnere ist. Dies zeigt das Sanskrit deutlich, wo Neutrum und Wurzelwort so oft durch nichts verschieden sind. Das Neutrum ist also noch halb Wurzelwort. Daß dies aber so ist, wird durch Ew. Hochwohlgebornen Bemerkung sehr schön erklärt. Nur das so lebendig hervortretende, daß man Geschlecht daran unterscheiden zu müssen glaubte, wurde sorgfältiger organisirt. Daß Dual u. Plural mehr homonyme Casus haben, als der Singular läßt sich wohl daher ableiten, daß man diese Formen ursprünglich weniger brauchte, und daher auch sorgloser behandelte.
Daß Ew. Hochwohlgebornen meine Abhandlung über die Buchstabenschrift einer so verweilenden Aufmerksamkeit gewürdigt haben, ist mir unendlich schmeichelhaft gewesen, und noch mehr hat es mich gefreut zu sehen, daß meine Ideen mit den Ihrigen übereinstimmen. Denn die Verschiedenheit unsrer Ansicht scheint mir, wenn sie noch eine ist, eine höchst geringe. Sie sagen: die Buchstabenschrift wäre schon in den frühesten Zeiten virtualiter vorhanden gewesen, wenn sie auch nicht in Ausübung gebracht wurde. Wenn Sie damit die Stelle meiner Abhandlung vergleichen, wo ich S. 14. vom geistigen Theile des Alphabets, noch ohne Zeichen fürs Auge, spreche, so werden Sie sehen, daß es im Grunde dasselbe ist. Ich glaube nur nicht, daß die Zeichen dann lange fehlen konnten. Dauernde[h] Stoffe waren dazu nicht nothwendig. Die Hauptsache war nur, daß man den Ton im Bild schuf. Denn es scheint mir im Menschen zu liegen, daß, was sein Geist sehr lebendig ergreift, ihn auch reizt, es sich durch alle Sinne anschaulich zu machen. Ein großer Zeitraum konnte also, meines Erachtens, nicht zwischen dem Aussprechen u. dem Bezeichnen d eines abgesonderten Buchstabens, den man als Sylbenelement, nicht als ein eignes Wort, erkannte, liegen.
Rémusats Aufsatz[i], wie ein Chinesischer Autor die Buchstabenschrift schildert, ist mir leider nicht bekannt. Der Chinesischen Sprache die Buchstabenschrift, unsre oder die Indische, anzu-|7*|eignen, scheint mir auf keine Weise unmöglich, nicht einmal schwierig. Aber daß die Chinesen es schwerlich je thun werden, liegt, dünkt mich, darin, daß in ihrer Ansicht ihre Schrift wirklich ein Theil der Sprache ist. Sie muß also mit jedem irgend denkenden Chinesen wahrhaft verwachsen seyn. Dies liegt zum Theil in der Armuth der Sprache an Wörtern u. überhaupt an Lauten, u. zum Theil in andren Umständen. So drückt sich die Verwandtschaft der Begriffe im Chinesischen sehr stark in den Schriftzeichen u. soviel ich habe bemerken können, gar nicht in den Lautzeichen aus.
Des index verborum zur Bh.-G. will ich Ew. Hochwohlgebornen auf keine Weise berauben. Ich habe freilich keinen über alle darin vorkommende Wörter, aber über die mich interessirenden habe ich mir einen genügenden gemacht, u. auch aus allen philosophischen Stellen des Manus die Wörter hinzugefügt, so daß ich ziemlich leicht in beiden Schriften die Stellen auffinden kann. Diesen ganzen Theil des Manus habe ich in diesem Sommer mir abgeschrieben u. wörtlich übersetzt, u. aus dieser Arbeit viel Nutzen gezogen. Auch habe ich immer den Scholiasten gelesen, u. auch viel aus ihm abgeschrieben – was ich nemlich verstand. Denn ihn ganz u. leicht zu verstehen, behaupte ich keinesweges.
Das pantheistisch streichen Ew. Hochwohlgebornen ja aus, wo es sich betreten läßt. Es thut hier gar nichts zur Sache. In meiner Abhandlung über das Lehrsystem der Gita habe ich schon ausdrücklich gewarnt, nicht auf Krischnas Lehren anzuwenden, was man gemeinhin vom Pantheismus praedicirt. Auch freut es mich zu sehen, daß Ew. Hochwohlgebornen auch nicht mit den Ideen Ihres Bruders über die Gita übereinstimmen, die ich gar nicht theilen kann. Indeß Pantheismus muß man doch das System, meiner Meinung nach, nennen. Die Sache scheint mir darauf zu beruhen, daß das Kriterium des Theismus die Schöpfung aus Nichts ist. Gerade diese verwirft das Indische System gänzlich. Wo nun die Welt nicht geschaffen, sondern gleich ewig mit Gott ist, da ist Dualismus, wo eine selbständige u. unabhängige Welt Gott ent-|8*|gegensteht, oder Pantheismus, den ich aber bloß darein setze, daß die Welt immanent in Gott ist. Nicht einmal umkehren läßt sich der Satz schlechthin, wie deutliche Stellen der Gita beweisen. Dies schließt nun den Spiritualismus nicht aus, der vielmehr so stark ist, daß Welt u. Materie ja fast zu durch Zauber hervorgebrachtem Schein werden, es schließt ebensowenig eine Absonderung des Menschen von der Gottheit aus. Diese letztere scheint mir aber auch in allem Pantheismus statt finden zu können, da auch im strengsten der Mensch sich zu Gott doch immer wie Theil zum Ganzen verhielte. Ich könnte übrigens auch in meiner, Ihnen noch unbekannten Abhandlung ohne Anstand das pantheistisch wegstreichen. Denn ich habe mich gar nicht darauf eingelassen über das System zu sprechen, es in die Reihe der andren bekannten zu classificiren, oder sonst etwas darüber zu bestimmen. Ich habe bloß gesucht, die in der ganzen Gita zerstreuten Lehrsätze zu sammeln, u. mit den Beweisstellen zu ordnen. Meine ganze Abhandlung ist eigentlich nur ein ausführliches Argumentum. Darauf allein habe ich mich beschränkt u. aus vielen Gründen. Auf diese Weise aber kann meine Arbeit dem, der nur das Gedicht selbst studiren will, nützlich seyn. Ich kann nicht läugnen, daß es mir viel Mühe gemacht hat, ehe ich mir das Ganze habe recht vor Augen stellen können, u. ich will mich glücklich schätzen, wenn Sie finden sollten, daß es mir gelungen ist.
Mein Brief ist aber von einer übermäßigen Länge geworden. Der Inhalt des Ihrigen hatte mich aber so angezogen, daß es mir unmöglich gewesen wäre, nicht auf jede einzelne Stelle desselben wieder einzugehen. Erhalten Sie mir Ihr wohlwollendes Andenken u. Ihre Freundschaft, und nehmen Sie die Versichrung meiner ausgezeichnetesten Hochachtung u. Ergebenheit an.Humboldt
Berlin, den 5. März, 1826.
Fußnoten
- a |Editor| Oben rechts in Schlegels Handschrift: d. 5ten März 26.
- b |Editor| Anm. Leitzmann S. 285f.: Zur Feier der Dampferfahrt Friedrich Wilhelms III. auf dem Rhein bei Bonn am 14. September 1825 hatte Schlegel ein deutsches und ein lateinisches Gedicht in Distichen verfaßt und bald darauf drucken lassen: "Die Huldigung des Rheins" und "Fausta navigatio regis Friderici Guilelmi III., cum universo populo acclamante navi vaporibus acta Bonnam praeterveheretur".
- c |Editor| Anm. Leitzmann S. 286: Im Namen der Univeristät Bonn hatte Schlegel zum silbernen Professorjubiläum des berühmten Naturforschers Blumenbach am 19. September 1825 eine epistula gratulatoria verfaßt. – "Viro clarissimo, Ioanni Friderico Blumenbach, Medicinae Doctori, In Academia Georgia Augusta Gottingensi Professore Medicinae Primario ... S. P. D. Rector et Senatus Academiae Borussicae Rhenanae", Bonn: Universität 1825.
- d |Editor| Siehe hierzu den zitierten Briefauszug in Schlegels vorherigem Brief.
- e |Editor| Leitzmann S. 195: übertragen.
- f |Editor| Leitzmann S. 196: Sie.
- g |Editor| Leitzmann S. 196: einzelne.
- h |Editor| Leitzmann S. 199: Daurende.
- i |Editor| Anm. Leitzmann S. 285: "Sur un vocabulaire philosophique en cinq langues, imprimé à Peking" Mélanges asiatiques 1, S. 153.