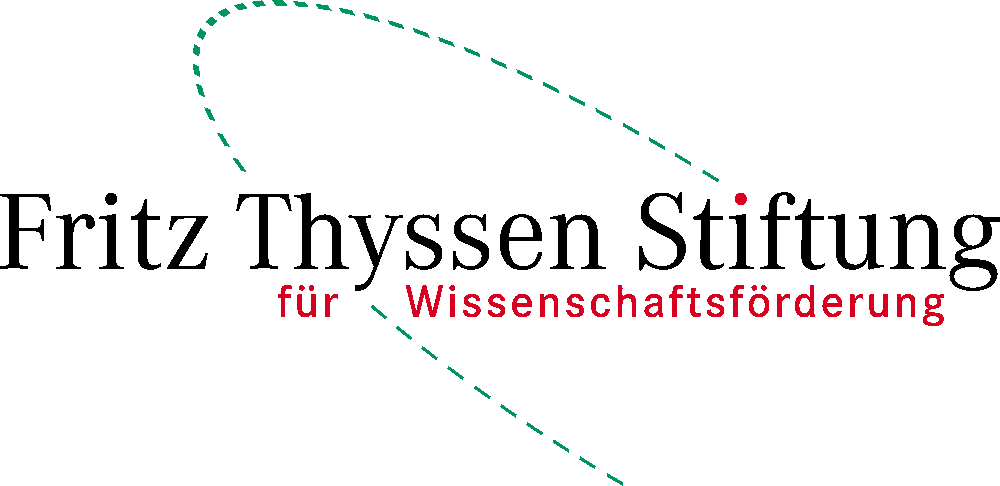Wilhelm von Humboldt an Friedrich Gottlieb Welcker, 25.09.1823
Tegel, 25. September 1823.|1*| Ihre beiden gütigen Briefe, liebster Freund, vom 26. v. M. [a] u. den kleineren, besonders für Herrn Professor d’Alton[b] bestimmten, habe ich erhalten u. sage Ihnen in meinem u. meiner Frau Namen meinen herzlichsten Dank für alles Liebe u. Freundschaftliche, was beide für uns enthalten. Herrn Prof. d’Alton habe ich leider nicht gesehen. Er hat vermuthlich nicht Zeit gehabt, mich hier auf dem Lande aufzusuchen. Wenn ich mich nicht irre, ist er derselbe, der mir schon aus ziemlich frühen Jahren als ein überaus geistvoller Mann bekannt ist. Ich habe desto mehr bedauert, seine Bekanntschaft nicht gemacht zu haben, denn ich habe ihn auch früher nie selbst gesehen. – Ich muß zwar fürchten, daß diese Zeilen Sie nicht in Bonn finden, da Sie, wie Sie mir schrieben, einige Reisen zu machen gedachten, ich möchte aber doch auf keinen Fall meine Antwort noch länger verzögern. Schlegel habe ich auf seinen letzten Brief nicht mehr geantwortet, da ich überzeugt war, daß er schon abgegangen seyn mußte, u. er wohl längere Zeit ausbleibt, obgleich er mir nie bestimmt geschrieben hat, wie lange er sich in London aufhalten wird. Ich bin überzeugt, daß seine Reise seinen Studien sehr beförderlich seyn wird. Ich weiß nicht, ob seine letzten Aufsätze in der Indischen Bibliothek Ihnen auch so sehr gefallen haben; uns außerordentlich. Sie scheinen zwar keines sehr wichtigen, noch weniger tiefen Inhalts, aber sie sind doch so geistvoll verfaßt, u. so hübsch geschrieben, daß Sie <sie> , dächte ich, jedem Leser sehr viel Interesse einflößen müssen. Ich kann es mir denken, daß meine Begeisterung über den Bhagavad Gita, wie Sie es mit Recht nennen, Ihnen hat befremdend vorkommen müssen. Es giebt zwar einige Stellen, die auch in der Uebersetzung frappiren u. erhaben u. tief erscheinen müssen. Auch ist die ganze Scene, im Angesicht zweier feindlichen Heere zu philosophiren, u. viele Gesänge hindurch die Waffen ruhen zu lassen, im höchsten Grade wunderbar, aber großartig. Endlich wird diese Großartigkeit dadurch gesteigert, daß der Krieger u. Held sich scheut, das Blut so verwandter Geschlechter zu vergießen, u. der zum Menschen gewordene Gott diese Schwachheit bekämpft, u. ihm zeigt, daß doch Alles Lebendige nur diesen großen Kreisgang |2*| durch den Tod zu neuem Leben gehen muß. Allein Alles dies ist sehr weit entfernt, das, was ich Schlegel schrieb, vor den Augen dessen zu rechtfertigen, der nur die Uebersetzung, wie gut sie selbst sey, liest. Das Eigentliche, was doch keine Uebersetzung nachbilden kann, liegt in dem Ton, dem Zusammendrängen u. Auseinanderlegen der Gedanken in die einzelnen Worte, der Folge der Gedanken u. Bilder, der Art der Metaphern, u. in dem Unbegreiflichen, was sich, weil es unzertrennlich der Sprache anklebt, nicht analysiren u. angeben, aber doch darum nicht wegläugnen läßt. Ich habe noch nicht Gelegenheit gehabt, historisch je das Alter dieser Indischen Gedichte zu untersuchen, u. weiß also nicht, ob sie in ein so sehr hohes über Homer hinausgehen mögen. Es scheint mir aber darin auch Vieles nur relativ zu seyn. Denn selbst das uns näher Stehende, u. mithin Jüngere kann ja durch die Abgeschiedenheit, in der es entstanden ist, dem Urzustande der Menschheit näher liegen, als das in der That bei weitem Aeltere. Das aber nun ist mir eine unumstößliche Ueberzeugung, daß diese Indischen Gedichte eine Farbe des Alterthums an sich tragen, gegen die Homer gewissermaßen jung erscheint. Hierzu tritt nun die Eigenthümlichkeit hinzu, daß sich dieses Alterthum gerade in philosophischer u. theosophischer Tiefe, aber verbunden mit jugendlich scheinenden u. reizenden Bildern ausspricht. Ich glaube, daß man ohne Vorurtheil sagen kann, daß man eigentlich immer nur in der Ursprache eine Nation selbst in ihrer Individualität reden hört, in der Uebersetzung kommt immer nur das Material der Gedanken zurück, u. das wenige, was die beste auch von der Form beibehält, wird in der Wirkung wahrer Aehnlichkeit wieder durch die Veränderung geschwächt, die selbst das Material in der neuen Form erleidet. Dies gerade, daß man die Nation selber hört, halte ich für den höchsten, vielleicht einzigen Nutzen u. Reiz des Studiums von Sprachen, unabhängig von den Zwecken dadurch sonst nicht zu erlangender Einsichten oder Notizen, u. erhalten, |?| u. je älter eine Nation ist, desto mehr steht sie gerade in einer solchen Verbindung mit ihrer Sprache, als nöthig ist, das Studium dieser wahrhaft anziehend zu machen. Alles wahre Erkennen u. Wissen muß doch am Ende darauf hinausgehen, das zu erreichen, was der Mensch, seinem Vermögen, das Universum zu erfassen u. selbst mit umzuschaffen, nach, wirklich ist, die Kraft u. die Begeisterung des Seyns werden aber nicht eigentlich verstärkt u. entzündet durch etwas, was sich bloß erkennen u. begreifen läßt, sondern nur durch die Anschauung dessen, was der Mensch schon einmal gewesen ist, u. das Erahnden dessen, was er seyn kann. Darum ist, wenn man alle Mittelzwecke vergißt, u. nur auf das Letzte u. Wesentlichste geht, wahre Erweiterung der Erkenntniß nur wahre Erweiterung des Daseyns, u. diese ist auf histori|3*|schem Wege nur durch Anschauen gewesenen Daseyns möglich. Insofern nun das Studium einer wichtigen Originalsprache allein dies Anschauen in einiger Vollständigkeit gewähren kann, nenne ich eine darin gemachte größere Erfahrung, wie z. B. das Lesen des Bhagavad Gita, ein so wichtiges Lebensmoment, daß man sich Glück wünschen kann, das noch, ehe man hinweggeht, erlangt zu haben. Insofern man immer eine stille Sehnsucht in der Seele nährt, die verschiedenen Arten, in welchen sich der menschliche Geist groß u. das menschliche Gemüth groß zeigen, selbst angeschaut u. gefühlt zu haben, so ist ein Theil dieser Sehnsucht gestillt, u. eine Beruhigung für das Hinaustreten erlangt. Denn wenn ich mir denke, wie man wohl, ohne ekle u. mir sehr fremde Sattheit am Leben, auf eine edle u. würdige Art den Kreislauf hier so vollendet zu haben denken kann, daß man nicht voraussieht, daß leicht etwas hinzukommen könnte, so ist es nicht durch Vollendung einer Reihe von Thaten, noch einer Masse von Richtungen, nicht durch ein Erschöpfen eines Kreises des Wissens, denn das Thun u. das Wissen sind nie aufhörende Reihen von Einzelheiten, durch die man doch nie zur Unendlichkeit gelangt, aber wohl dadurch, daß jedes Vermögen, das man in sich spürt, einmal einen Gegenstand in sich gefunden hat, in dem es ganz aufgegangen ist, wo nun jede neue Beschäftigung gleichsam nur eine Wiederholung seyn würde. Nur also, was im Stande ist, ein Geistes- oder Gemüthsvermögen so zu beschäftigen u. zu bewegen, kann für den Menschen eine absolute Wichtigkeit haben, eine solche, bei der Leben u. Tod in Betrachtung kommt; alles Uebrige fällt in den Kreis des Zufälligen u. Außerwesentlichen, u. wird, wie man den ernsten Gedanken des Todes faßt, so bis zur Gleichgültigkeit entfärbt, wie Kohlen ihren Schimmer verlieren, wenn daneben eine Flamme auflodert. Sie müssen mir verzeihen, liebster Freund, daß ich hierüber so weitläuftig geworden bin. Allein ich möchte sehr ungern bei Ihnen in den Verdacht kommen, Schriften, die, aus zufälligen Umständen, jetzt von Wenigen in der Ursprache gelesen werden, darum zu überschätzen, u. einer Kenntniß, die jetzt nicht häufig seyn kann, einen zu hohen Werth beizulegen; ich mußte Ihnen daher weitläuftiger auseinandersetzen, wie ich in meiner individuellen Ansicht eine Aeußerung genommen hatte, die wirklich aus einem momentanen u. individuellen Gefühl floß, die aber darum nicht weniger in mir wahr u. dauernd ist, u. seyn wird. – Bei Schwencks Recension im Hermes, die ich zu lesen suchen werde[c], fällt mir eine von Voß Aristophanes, oder vielmehr ein philosophischer Aufsatz über Aristophanes selbst ein. Da Sie sie mir nicht nennen, glaube ich nicht, daß diese Recension auch von Schwenck herrührt.[d] Es war sehr gut u. nöthig, Vossen einmal zu sagen, daß er wirklich, u. ordentlich absichtlich untreu übersetzt, nur hätte ich gewünscht, daß es mit noch mehreren Beispielen geschehen wäre. Ueber die Natur des |4*| Komischen an sich u. im Aristophanes war viel Gutes gesagt, allein das wahre Wesen der Sache doch, wie es mir schien, nicht erreicht. – Die Bonn ische Gypssammlung muß ja sehr hübsch u. ansehnlich seyn, u. wo nun einmal ein Grund vorhanden ist, wird das Vermehren leicht. – Auf die den Philostrat, den ich bisher so gut, als gar nicht kannte, bin ich ungemein begierig. Er wird doch nunmehr, hoffe ich, unverzüglich erscheinen. Die Bearbeitung konnte gewiß nur dem gelingen, der, wie Sie, mit lebendiger Phantasie eine so sehr ausgebreitete Kenntniß der vorhandenen Kunstwerke besitzt. Denn gewiß haben Sie Recht zu sagen, daß diese durchaus nöthig ist, um sich in den Gemälden zurecht zu finden. Es muß Sie auch diese Beschäftigung zu schönen Bemerkungen über die verschieden- und gleichartige Composition der Alten in Gemälden u. Basreliefs geführt haben. – Ihre Darstellung der Polygnotischen Gemälde werde ich mit großer Freude empfangen.[e] – Ich wünsche von Herzen, daß Sie recht bald Muße zur Ausarbeitung Ihrer Aeschyleischen Ideen finden mögen. Ich bin sehr ungeduldig, sie zu sehen. Gewiß ist Aeschylus auch schon im Alterthum nicht so gewürdigt u. gefaßt worden, wie er eigentlich verdient hätte. Die Versuche, die Titel u. Fragmente der verloren gegangenen Stücke nach Trilogien zu ordnen, müssen eine sehr unterhaltende Arbeit gewähren, u. zugleich auf feine u. für die Dramatik der Alten wichtige Bemerkungen zu führen. – Sehr schmeichelhaft ist es mir, daß Sie sagen, Gelegenheit gefunden zu haben, auch von meinen Bemerkungen Gebrauch gemacht zu haben. Ich wünschte aber nicht, daß Sie ihnen zu viel Gewicht beilegten, u. am wenigsten möchte ich die Vergleichung der Sagen verschiedener Völker gewissermaßen ganz verwerfen. Meine Meinung war nur, zu warnen, daß man nicht aus zu wenigen Zügen der Aehnlichkeit gleich auf Identität, noch weniger aber, auch bei größter Aehnlichkeit, auf Verwandtschaft schließen möchte. Ganz gleiche Mythen können sehr füglich, jede selbständig, an verschiednen Orten emporkommen. – Meine Frau hat mit wirklich recht glücklichem Erfolg die Böhmischen Bäder gebraucht, u. grüßt Sie auf das freundschaftlichste. Wir sind jetzt hier fast alle vereinigt, gehen aber ba in wenigen Tagen nach Berlin.
Leben Sie recht herzlich wohl u. schreiben Sie mir recht bald wieder. Mit der hochachtungsvollsten Freundschaft der IhrigeHumboldt.
Fußnoten
- a |Editor| Der Brief ist offenbar nicht erhalten. [FZ]
- b |Editor| Joseph Wilhelm Eduard d’Alton (1772–1840), Anatom, Archäologe, Kupferstecher und Kunstkritiker. Seit 1818 außerordentlicher Professor für (antike) Kunstgeschichte an der Universität Bonn.
- c |Editor| Wahrscheinlich ist damit die Rezension Schwencks zum Werk E.T.A. Hoffmanns gemeint, mit dem Titel: Ueber E.T.W. [sic] Hoffmann’s Schriften. In: Hermes oder kritisches Jahrbuch der Literatur, Erstes Stück für das Jahr 1823, Nr. XVII der ganzen Folge, S. 80–143. Dort ist der Beitrag namentlich nicht gekennzeichnet, sondern trägt lediglich die Signatur "38.". Die Rezension wird Schwenck zugeschrieben: Detlef Kremer (Hrsg.) (2010): E.T.A. Hoffmann. Leben – Werk – Wirkung. 2., erweiterte Auflage, Berlin: DeGruyter, S. 148. [FZ]
- d |Editor| Die Rezension ist am Ende mit "11." gekennzeichnet, daher ist es unwahrscheinlich, dass sie von Schwenck stammt, der mit "38." zeichnete. [FZ]
- e |Editor| Die Abhandlung über die "Die Composition der Polygnotischen Gemälde in der Lesche zu Delphi" erschien erst 1849 in den Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1847, S. 81–151. Ein Sonderdruck erschien bereits 1848. Der Text entstand gleichzeitig mit der Beschäftigung an den Gemälden des Philostratos; siehe Welcker a. O., S. 84. [FZ]