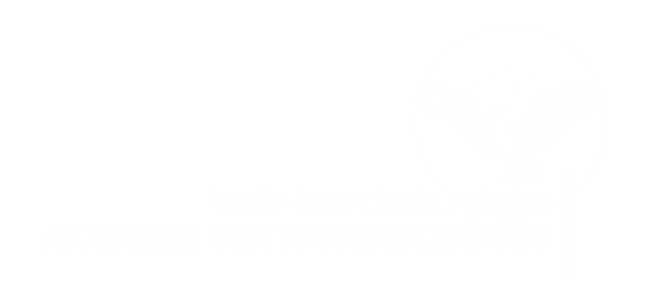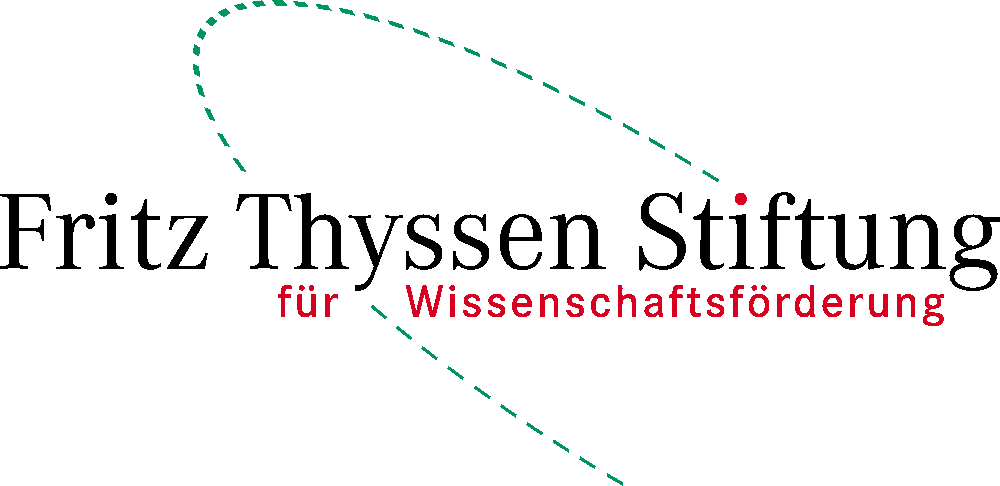Franz Bopp an Wilhelm von Humboldt, 30.09.1826
Ew. Excellenzhabe ich die Ehre meinen lebhaftesten Dank auszudrücken für die gnädige
Theilnahme, welche Sie meiner Beurtheilung der
Grimm. Grammatik geschenkt haben, und für die mir
mitgetheilten höchst schätzbaren und lehrreichen Bemerkungen, die ich nicht
versäumen werde so gut ich im Stande bin zu benutzen, indem ich versuchen werde
die gemachten Einwände soweit es möglich ist, zu widerlegen, wobei ich denke,
daß eine schwache Widerlegung besser ist als gar keine. Ich nehme mir die
Freiheit Ew. Excellenz den 5ten und 6ten Bogen meiner ersten Abfassung
beizulegen. Seite 3 u. s. w. des fünften Bogens gebe ich eine gedrängte
Zusammenfassung der gewonnenen Resultate in Betreff des Vocalwechsels, wobei ich
einen Einwand vorgesehen und zu entkräften gesucht habe durch die Bedeutung, die
der Umlaut im Deutschen Conjunktiv, wie
war,
wäre, gewonnen hat, weil das wahrhaft Charakteristische, der Modus-Vocal
i, der den Umlaut erzeugt hat, untergegangen.
Vielleicht wird man sich bei Untersuchungen über den Ursprung der Sprachformen
durchaus von dem Gefühl lossagen müssen, welches durch die Gewohnheit beim
Gebrauche der Muttersprache, wie der fremden, sich in uns erzeugt, weil was die
besonnene Sprachphilosophie Ew. Excellenz mehr als irgend etwas anderes
beurkundet, die unabhängige kritische Untersuchung das Gefühl gar oft auf dem
Abwege findet. Bei der 6ten Klasse ließe sich der unterdrückte Einfluß der
Endungen durch das eingeschobene
a erklären, was die Endung und den Stamm mehr auseinander reißt, die
sich nun, wie zwei fern stehende Feinde keinen Abbruch mehr thun. Derselbe Grund
läßt sich vielleicht, obwohl weniger zuverläßig, auf die 1ste Klasse anwenden.
Hier wird das einmal hervorgebrachte Guna
durch den Wachsthum der Endungen nicht mehr in seine Schranken zurückgeführt,
weil die Endungen durch das zwischentretende
a ihre Kraft verloren haben, das Guna blieb also wie erstarrt und gefroren, und konnte nicht mehr
flüßig gemacht werden. Wenn man die zweite Conj. wie im Griech. die auf μι als die einfachste und kräftigste, für die
ursprüngliche ansieht, so hat man einiges Recht anzunehmen, daß dem
bodhâmi ein älteres
bôdhmi vorausgegangen. Alle Einwände zu beseitigen und alle Zweifel zu heben
scheint mir durchaus unmöglich. Man könnte aber sagen, daß man die Gesetze in
dem Gesetzmäßigen suchen müsse, und gesetzmäßig zeigt sich der Vocalwechsel bei
den 3 letzten Conjugationen, bei der 3ten und 4ten wirken die Endungen auf die
Vermittelungssylben, dagegen dehnt sich bei
karômi der Einfluß bis zum Stamme aus. Sollte man bei
tha der 2. Pluralperson nicht ein Gewicht auf die Aspiration legen
dürfen, die nach der Aussprache der Indier einen eigenen Buchstaben vertritt, so
daß {tha} eigentlich die Verbindung von
t und
h ist, und gewiß stärker als
mi,
si und
ti? Beim Imperativ nehme ich
dhi für die ursprüngliche Endung, die sich nur nach Consonanten gehalten
hat, aber dem gr. θι analog ist. Man könnte
auch sagen, daß im Pl. die zweite P. durch die Analogie der beiden übrigen im
Guna gehalten werde, dieses würde besser
auf das
ta von
advishṭa u. s. w. passen. Am meisten Schwierigkeit macht die 1. P. imper.
Dagegen läßt sich wieder in den romanischen Sprachen der Vocalwechsel aus meiner
Theorie des Guna erklären,
je tiens,
je tenois,
nous tenons. Die 3. P. pl. praes. schließt sich an den Sing. an, vielleicht wegen
der Verstummung, der Endung oder um den Verlust des t in anderen Dialekten zu decken. Das Perfekt scheint
aber die kürzeren Vokale auch im Sing. zu lieben, daher
je bois,
nous buvons,
je bus. Die Ursache ist mir nicht klar.
Ew. Excellenz gelehrte Bemerkungen über den Infinitiv[a], die ich hier beilege, habe ich mit dem lebhaftesten Interessen gelesen; es ist eine treffliche Zugabe zu Ihrer meisterhaften Behandlung dieses Gegenstandes in der Indischen Bibliothek, und müßte durchaus gedruckt werden. Besonders gefreut hat mich die scharfsinnige und originelle Auffassung des Artikels, den Ew. Excellenz in die Kategorie der Zahlwörter stellen. In Betreff des momentanen Merkmals möchte ich doch bemerken, daß man bei Eigenschaften überhaupt unterscheiden kann, ob sie auf eine Zeit beschränkt werden oder ob sie unabhängig von der Zeit als ein dem Gegenstand inwohnender Charakterzug dargestellt werden. Von dem Sanskritischen Suffix a (wie arim̃dama) habe ich in dem noch ungedruckten Theil meiner Gr. gesagt, daß es sich vom Part. praes. dadurch unterscheide, daß die Handlung, Eigenschaft oder Zustand nicht als auf die gegenwärtige Zeit beschränkt oder vorübergehend, sondern als ein bleibendes Merkmal gedacht wird. Wenn man sagt, das Blatt ist grün, so glaube ich, daß man von der Zeit ganz abstrahire, und also unentschieden lasse, ob es beständig grün bleibe.
Allein S. 7 bestimmen Ew. Excellenz den Begriff des Verbums mit größter Schärfe und Richtigkeit auf eine Weise, daß das momentane ganz zur Nebensache wird. Zudem kann man auch beim Verbum von der Zeit abstrahiren, in Sätzen wie, das Feuer brennt oder wärmt. Ich zweifle nicht, daß man in Sätzen wie, er kann alles, er darf alles, einen ausgelassenen Infinitiv zu suppliren hat; allein wie erklären Ew. Excellenz den Accusativ in corayâmâsa, da man sonst as nicht mit dem Acc. konstruirt?
Hierbei habe ich die Ehre Ew. Excellenx |sic| die Fortsetzung meiner Abhandlung zu überschicken, mit der Bitte derselben Ihre geneigte Theilnahme zu schenken und die Schwächen, die Sie darin wahrnehmen, mit Nachsicht zu beurtheilen.
Recht sehr hat es mich gefreut zu erfahren, daß das Bad der Frau Ministerin gut bekommen ist.
In tiefster EhrerbietungEw. Excellenz
Ganz gehorsamster
Bopp.
Berlin, d. 30. Sept. 1826.
Fußnoten
- a |Editor| Humboldts Brief an Maximilian Schmidt, datiert: Tegel, den 28. October 1826, wurde unter dem Titel "Ueber den Infinitiv" in der Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 2, 1853, S. 241–251, veröffentlicht. Vgl. hierzu auch den vorhergehenden Brief Humboldts an Bopp vom 26. September 1826.