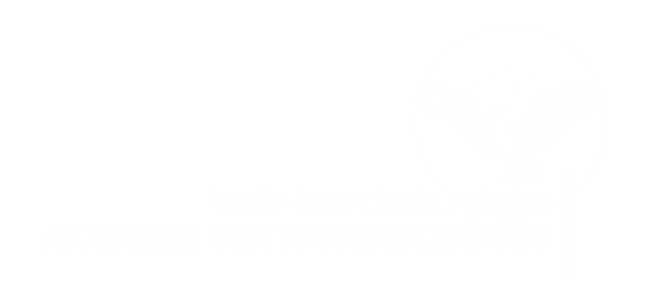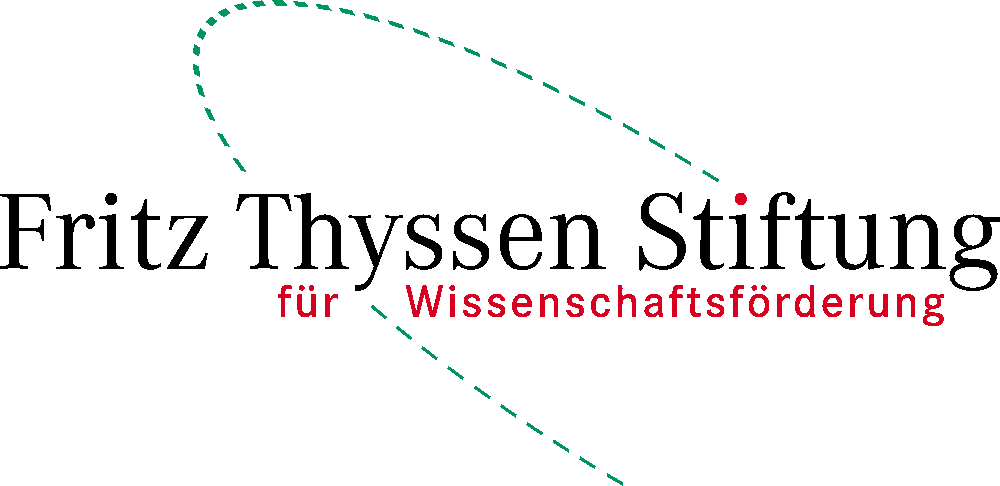Wilhelm von Humboldt an Franz Bopp, 04.01.1821
|1*| Ich bin wahrhaft beschämt, Ew Wohlgeboren so gütigen und
ausführlichen Brief vom 20. Jun. v. J. erst heute
zu beantworten. Ich erhielt ihn aber erst spät, und als ich auf dem Lande war. Das Lesen Ihrer interessanten
Schrift zog mich dergestalt an, daß ich den Vorsatz
faßte, nunmehr einen ernstlichen Versuch mit der Erlernung des Sanskrit zu
machen. Dennoch konnte ich hierzu erst in der Mitte Novembers, wo ich zu meinen Büchern in die Stadt zurückkehrte, kommen. Nachdem ich nun einige, wenn auch
noch sehr geringe <|![]() WvH| Kenntniß> |
WvH| Kenntniß> |![]() Schreiber| erlangt habe, bin ich zu einer neuen Lesung Ihrer Abhandlung geschritten, und kann Ew. Wohlgeboren
nicht sagen, wieviel Nutzen und Vergnügen ich daraus geschöpft habe.
Schreiber| erlangt habe, bin ich zu einer neuen Lesung Ihrer Abhandlung geschritten, und kann Ew. Wohlgeboren
nicht sagen, wieviel Nutzen und Vergnügen ich daraus geschöpft habe.
Sie ist gewiß der erste so ausgezeichnet gelungene Versuch einer vergleichenden Analyse mehrerer Sprachen, und über die Richtigkeit der aufgestellten Hauptsätze kann, meines Erachtens, kein Zweifel obwalten. Sie haben vollkommen bewiesen, daß auch das Sanskrit nur durch Agglutination seine grammatischen Formen bildet, und daß der von Fr. Schlegel gemachte Unterschied zwischen Sprachen, welche diese und anderen, welche die Inflexion anwendeten, so wie ich immer geglaubt, ein aus mangelhafter Sprachkenntniß entstandener Irrthum ist. Es ist ungemein zu wünschen, daß Ew Wohlgeboren diese Arbeit fortsetzen, und auch die Declinationen, und dann die Wortbildung |2*| selbst abhandeln mögen.
Gegen einiges Einzelne aber hätte ich allerdings Bedenken, ob ich gleich selbst noch sehr zweifelhaft bin, ob Ew Wohlgeboren Meynung nicht die richtigere seyn möchte. Ich gestehe aber, daß ich mich noch nicht davon überzeugen kann, daß das Futurum der Griechischen Conjugation, sammt der davon abgeleiteten Zeiten, aus einer Verbindung der Stammsilbe mit dem auxiliare entstanden seyn soll. Schlagende Beweisgründe, daß dies geradezu unmöglich sey, wüßte ich allerdings nicht anzugeben. Allein die Behauptung selbst scheint mir auch nicht solche zu haben, welche die Ueberzeugung abnöthigten. Daß der Gebrauch dieser Verbindung gerade die Bedeutung des Futuri gegeben habe (S. 45.) kann doch einer willkührlichen und nicht ganz natürlichen Annahme ähnlich scheinen. Ew. Wohlgeboren führen zwar das Französische j’aimer-ai an, und so wie man ich werde lieben durch ich habe zu lieben umschreiben kann, so könnte man es wohl auch durch ich bin da, um zu lieben. Allein geradezu erlaubt das Griechische doch wohl nicht die Zusammenstellung mit dem Französischen. Dieses ist eine aus wirklicher Corruption einer vorhandenen gebildeten Sprache entstandne, und diese Conjugations-Form gehört gerade dieser Corruption an. In solchem Verhältniß stand, wie ihr ganzer Bau beweist, die Griechische Sprache offenbar nicht. In den Französischen und in ähnlichen Spanischen Phrasen findet man auch, wie Sie selbst bemer-|3*|ken, das Pronomen zwischen beide Verben eingeschoben. Auch dies fehlt hier. Daß Sprachen für die Haupttempora eine Bezeichnung haben, ist in sich natürlich und gewöhnlich, und es ist mir nicht glaublich, daß dem Griechischen eine solche, für das Futurum ganz eigentliche gefehlt haben sollte. Im Fut. 2. ist die Verkürzung (Elision des DoppelConsonanten) Zusammenziehung, und in einigen Verben die Buchstabenveränderung sehr merkwürdig. Wäre das Fut. 2 immer Verbindung mit dem Auxiliar, nur mit weggeworfenem σ (so wie das fut. 1. oft in dieser Annahme ε wegwirft) so ließe sich, dünkt mich, nicht erklären, warum στέλλω in σταλῶ verwandelt wird. Diese Veränderungen scheinen mir wahre Inflection, Absicht des Redenden, dadurch daß er das Wort für das Ohr auffallend macht, die Aufmerksamkeit auf eine andere Zeit, als die gegenwärtige zu richten. Eine ähnliche Beschaffenheit kann es mit dem σ fut. 1. haben, und die Wahl dieses Buchstabens ist nicht unnatürlich, da er kein wahrer Buchstabe, sondern mehr ein verstärkter Hauch, ein Zischlaut ist.
Indeß sind dies mehr Einfälle, als Wiederlegungen, und ich setze selbst auf dies Raisonnement um so weniger Werth, als ich doch auch glaube, daß in der Griechischen Conjugation sehr leicht eine mit dem auxiliare stecken kann. Der aor. 1. pass., ja die ganze Conjugation in ω sieht allerdings völlig so aus.
Ein andres Bedenken habe ich gegen die Vergleichung des Augments mit dem α privatiuum. Die Annahme
scheint mir zu |4*| künstlich. Ich stimme zwar auch Ew Wohlgeboren
Meynung bei, daß es nicht wahrscheinlich ist, daß der das Augment bildende Vocal gerade Vergangenheit bedeutet habe, und nun aus ihm und dem
verbum ein zusammengesetztes Wort gemacht sey. Aber
die Sprache will in vielen Fällen mit der Beschaffenheit der Töne eines Worts
den Begriff nachahmen, und es scheint mir eben so natürlich, daß sie daher dem
Ausdruck der Vergangenheit Silben,
vorgänglich <|![]() Humboldt| vorzüglich>
|
Humboldt| vorzüglich>
|![]() Schreiber| tönende Vocale voranschickt, um dadurch
die Vergangenheit gleichsam zu mahlen, als daß sie dem futurum durch Accentuirung oder sonst mehr
Raschheit, oder Stärke giebt, um die Kraft des Entschlusses und Willens, dessen
Begriff sich immer an die Zukunft knüpft, auszudrücken. Ew. Wohlgeboren erwähnen
gegen Ihre eigne Behauptung, daß dann auch die futura
augmente haben müßten. Hierbei muß ich bemerken, daß ich nicht
begreife, wie
Wilkins in seiner Grammatik § 157 das 7. tempus, welches nach § 154. 155. eben dies fut. 2. ist, zu denen rechnen kann, welche a
vor der Wurzel annehmen. Nach der Stelle in Ew Wohlgeboren
Schrift scheint dies nicht der Fall zu seyn, und die § 350 u. f.
gegebnen Beispiele haben auch kein augment.
Schreiber| tönende Vocale voranschickt, um dadurch
die Vergangenheit gleichsam zu mahlen, als daß sie dem futurum durch Accentuirung oder sonst mehr
Raschheit, oder Stärke giebt, um die Kraft des Entschlusses und Willens, dessen
Begriff sich immer an die Zukunft knüpft, auszudrücken. Ew. Wohlgeboren erwähnen
gegen Ihre eigne Behauptung, daß dann auch die futura
augmente haben müßten. Hierbei muß ich bemerken, daß ich nicht
begreife, wie
Wilkins in seiner Grammatik § 157 das 7. tempus, welches nach § 154. 155. eben dies fut. 2. ist, zu denen rechnen kann, welche a
vor der Wurzel annehmen. Nach der Stelle in Ew Wohlgeboren
Schrift scheint dies nicht der Fall zu seyn, und die § 350 u. f.
gegebnen Beispiele haben auch kein augment.
Eine zugleich sehr scharfsinnige und richtige Bemerkung ist es, wo Ew.
Wohlgeboren S. 38 sagen, daß die Sprachen oft einen ganz umgekehrten Gang
genommen haben, als der ist, welchen ihnen die Grammatiker anweisen. Sie
erwähnen dies bei Ge-|5*|legenheit der Ableitung der tempora vom Participium. Gewiß haben Sie sehr
recht, daß die Participien der Bildung der Conjugation vorausgehen, nicht aber nachfolgen, obgleich
auch dies mit Unterschied verstanden seyn will. Das Participium ist der constitutive Begriff des
Verbi, welches nichts anders ist, als die
Zusammenfassung eines Subjects mit einem Participium. Ich kann bei dieser Gelegenheit die
Bemerkung nicht unterdrücken, daß Ew Wohlgeboren wo Sie S. 13 vom Verbum sprechen, mir die von
Silvestre de Sacy in seiner allgemeinen Grammatik vorgetragenen Ideen im Sinn gehabt zu
haben scheinen. In demjenigen, was Sie gerade berühren, ist auch nichts, das ich
nicht unterschieben |sic|
[a] möchte. Allein sonst läugne ich nicht, daß ich, nach
genauem Studium der
Sacy’schen Schriften hierüber, mich
überzeugt habe, daß seine allgemeine Grammatik wirklich
ein höchst schwaches Buch ist, was auch viel Irriges enthält. Dagegen scheint
mir
Bernhardi in seiner kurzen Sprachlehre ungemein geistvoll und im Einzelnen richtig.
Es giebt auch in diesem Buch Kapitel, die ich nicht für gelungen halte, allein
die Entwicklungen der Grammatischen Urbegriffe scheinen mir vollkommen
erschöpfend. Vergleichen nur Ew Wohlgeboren in beiden Büchern einmal die Lehre
der tempora, wie consequent und
philosophisch sie in
Bernhardi ist, und gerade diese gründet sich
auf die richtigen Begriffe vom Participium und ist nur
durch sie möglich. Bei dieser Gelegenheit wünschte ich wohl |6*| von
Ihnen zu hören, ob das Sanscrit auch alle 12 tempora so vollständig, sey es auch durch Umschreibung
<|![]() Humboldt| bildet>
|
Humboldt| bildet>
|![]() Schreiber|, als das Griechische durch seine Conjugation, durch
τυγάνω
<|
Schreiber|, als das Griechische durch seine Conjugation, durch
τυγάνω
<|![]() Humboldt| τυγχάνω>
|
Humboldt| τυγχάνω>
|![]() Schreiber| und μέλλω. Merkwürdig ist es, daß das Mexicanische hierin ausgezeichnet vollständig ist.
Wilkins scheint mir von keinem festen
Begriff von der Zahl der möglichen und nothwendigen tempora ausgegangen zu seyn, wie doch jeder Grammatiker sollte, um beurtheilen zu können, wie die von ihm
bearbeitete Sprachen |sic| hierin die Forderungen des Denkens erfüllt. Um
aber auf das Participium zurückzukommen, so geht
dasselbe, als durch den Begriff und seinen Inhalt gegeben, gewiß der Bildung der
Conjugation voraus, aber als wirklich mit bestimmter
Endung versehene grammatische Form mag es doch in manchen Sprachen, und Fällen
wohl erst nach der Conjugation und durch sie selbst
gemacht werden.
Schreiber| und μέλλω. Merkwürdig ist es, daß das Mexicanische hierin ausgezeichnet vollständig ist.
Wilkins scheint mir von keinem festen
Begriff von der Zahl der möglichen und nothwendigen tempora ausgegangen zu seyn, wie doch jeder Grammatiker sollte, um beurtheilen zu können, wie die von ihm
bearbeitete Sprachen |sic| hierin die Forderungen des Denkens erfüllt. Um
aber auf das Participium zurückzukommen, so geht
dasselbe, als durch den Begriff und seinen Inhalt gegeben, gewiß der Bildung der
Conjugation voraus, aber als wirklich mit bestimmter
Endung versehene grammatische Form mag es doch in manchen Sprachen, und Fällen
wohl erst nach der Conjugation und durch sie selbst
gemacht werden.
Außer dem ungemein großen Interesse, welches mir der Hauptinhalt Ihrer Schrift eingeflößt hat, ist sie mir auch in vielen
Nebenquellen <|![]() Humboldt| Nebenpunkten>
|
Humboldt| Nebenpunkten>
|![]() Schreiber| überaus lehrreich gewesen. Mehreres
habe ich darin gefunden, was entweder in
Wilkins nicht steht, oder was wenigstens mir
darin entgangen war, so zB. die Verwandlung des
ś in k.
Schreiber| überaus lehrreich gewesen. Mehreres
habe ich darin gefunden, was entweder in
Wilkins nicht steht, oder was wenigstens mir
darin entgangen war, so zB. die Verwandlung des
ś in k.
Ew Wohlgeboren Brief, dessen Ausführlichkeit
mich sehr gefreut hat, ergänzt zum Theil
ihre <|![]() Humboldt| Ihre>
|
Humboldt| Ihre>
|![]() Schreiber| Schrift, da er
sich über die Declination erklärt, über welche jene
nichts enthält. Es ist mir neu gewesen, |7*| daß die Declination durch die Pronomina entstehen
solle. Von Einer Seite erscheint mir die Sache auf den ersten Anblick sehr
einleuchtend. Es ist ein scharfsinniger Gedanke, daß die Pronomina an die Substantiua gehängt werden,
um ihnen Leben zu geben, und in der That ist es in allem Reden des gemeinen g Volks auffallend, wie dasselbe sehr oft das Subject nicht eher auf das Verbum bezieht, als bis es ein Pronomen
dazwischen geschoben hat, wie wenn man sagt, der Mann, der
geht dort. So würde ich also ohne Bedenken die Endungen der 2. Declin. im Griechischen für das den Endungen
nachgesetzte Pronomen halten. Die andren mag man
es auf ähnliche Weise erklären können. Allein woher stammt nun
die Declination der Pronomina
selbst? Diese Frage scheint mir eine eigne Beantwortung zu erfordern.
Schreiber| Schrift, da er
sich über die Declination erklärt, über welche jene
nichts enthält. Es ist mir neu gewesen, |7*| daß die Declination durch die Pronomina entstehen
solle. Von Einer Seite erscheint mir die Sache auf den ersten Anblick sehr
einleuchtend. Es ist ein scharfsinniger Gedanke, daß die Pronomina an die Substantiua gehängt werden,
um ihnen Leben zu geben, und in der That ist es in allem Reden des gemeinen g Volks auffallend, wie dasselbe sehr oft das Subject nicht eher auf das Verbum bezieht, als bis es ein Pronomen
dazwischen geschoben hat, wie wenn man sagt, der Mann, der
geht dort. So würde ich also ohne Bedenken die Endungen der 2. Declin. im Griechischen für das den Endungen
nachgesetzte Pronomen halten. Die andren mag man
es auf ähnliche Weise erklären können. Allein woher stammt nun
die Declination der Pronomina
selbst? Diese Frage scheint mir eine eigne Beantwortung zu erfordern.
Ich möchte überhaupt glauben, daß sich das Entstehen der Declination nicht auf Eine Art allein erklären lasse.
Oft entstehen gewiß die Casus aus wirklichen Praepositionen. An einigen Americanischen, den Vaskischen und andren ist
dies unverkennbar. Ich habe mir auf diese Weise auch
immer <|![]() Humboldt| immer>
|
Humboldt| immer>
|![]() Schreiber| unsern Genitiv s
des
Manne-s erklärt, und diesen Endconsonanten als den Ueberrest von
aus angesehen. Im Griechischen und
Lateinischen aber möchte ich nicht behaupten, daß sich nur Ein einziger Casus so ableiten ließe.
Schreiber| unsern Genitiv s
des
Manne-s erklärt, und diesen Endconsonanten als den Ueberrest von
aus angesehen. Im Griechischen und
Lateinischen aber möchte ich nicht behaupten, daß sich nur Ein einziger Casus so ableiten ließe.
Eine andre Entstehungsweise scheint mir in dem zusammen-|8*|schmelzen mehrerer Dialecte in Eine allgemeine Sprache zu liegen. Es ist auch sonst bekannt, daß mehrere grammatische sogenannte Flexionen nur daher kommen, daß man in einer Periode der Bildung vielen an sich gleichbedeutenden Formen einen bestimmten Unterschied anwieß. So müßte ich mich sehr irren, wenn nicht de-r und de-n bloßer Dialect Unterschied wäre, und in einem deutschen Dialect (ich denke im Schweizerischen) den auch als Nomitatiuus zälte |sic|.
Eine dritte Art fügen nun Ew Wohlgeboren sehr scharfsinnig durch die Verbindung gleichbedeutender, aber verschiedener Pronomina mit den Stammsilben hinzu. Allgemein, glaube ich, läßt sich hierüber nichts entscheiden, sondern man muß in jeder <einzelnen> Sprache ihre Eigenthümlichkeit auffassen.
Ew. Wohlgeboren haben gewünscht, daß ich Ihnen über Ihre
Schrift und die Grundideen derselben meine Meynung umständlich
sagte, und dies wird mir für die Weitläuftigkeit dieses Briefes zur
Entschuldigung dienen. Ich muß Sie dessen ungeachtet um Erlaubniß bitten, noch
über
meine <|![]() Humboldt|
mein> |
Humboldt|
mein> |![]() Schreiber| eigenes Sanskritstudium Einiges hinzusetzen zu dürfen, und Sie
um die Ertheilung Ihres einsichtsvollen Rathes zu ersuchen.
Schreiber| eigenes Sanskritstudium Einiges hinzusetzen zu dürfen, und Sie
um die Ertheilung Ihres einsichtsvollen Rathes zu ersuchen.
Ihre Abschrift einiger Seiten des Hitopadesa hat es mir allein möglich gemacht, nur das Lesen anfangen zu können. Ich kann jetzt Alles lesen, ohne weiter nachzusehen, wenn gleich die eigentliche Geläufigkeit nur mit der Zeit kommen kann.
Damit Ew. Wohlgeboren den Standpunkt meiner Kenntniß oder |9*| vielmehr
Unkenntniß beurtheilen können, so schicke ich Ihnen eine Abschrift dessen, was
ich mir über die ersten Verse Ihres Nalus für mich angemerkt habe. Ich lerne ohne alle
mündliche Hülfe.
Wilken, der Sanscrit getrieben hat, ist lange wieder davon abgekommen;
Link macht nicht eigentlich fait davon;
Bernstein sehe ich nicht, und außer
diesen dreien und mir mag niemand hier nur lesen können. Ich habe zuerst
Wilkins Grammatik theilweise genau gelesen, theilweise eben nur
durchgesehen. Dann habe ich die mir von Ew Wohlgeboren geschickten einzelnen
Bogen über den
Hitopadesan <|![]() Humboldt| Hitopadesa> |
Humboldt| Hitopadesa> |![]() Schreiber| stellenweise gelesen, endlich mich,
auch mit Hülfe des
Wilson, den leider noch nicht ich selbst
besitze, den aber die Bibliothek hat, an Ihren Nalus gemacht. Dies zieht
mich am meisten an, allein ich halte es für gut, mit diesen drei Arten des
Studiums abzuwechslen.
Schreiber| stellenweise gelesen, endlich mich,
auch mit Hülfe des
Wilson, den leider noch nicht ich selbst
besitze, den aber die Bibliothek hat, an Ihren Nalus gemacht. Dies zieht
mich am meisten an, allein ich halte es für gut, mit diesen drei Arten des
Studiums abzuwechslen.
Das Alphabet habe ich so gründlich, wie möglich, studirt.
Es ist von einer wunderbaren Regelmäßigkeit und Vollständigkeit. Allein was mich
darin immer hindert und stört, ist, daß es für mich wenigstens völlig todt ist.
Ich kann mir durchaus keinen Begriff machen über sehr viele Punkte: über die cerebralen Consonanten, die Verschiedenheiten der
Nasenlaute, wenigstens in den ersten vier Classen, den Unterschied der
Aussprache des
anuswāra und entweder des
m oder eines der verschiedenen
n, über die des
visarga, das ja nicht bloß ein h, sondern immer ein ah zu seyn
scheint, auch wenn ein i vorausgeht. Ich wage daher
nicht laut zu lesen, und möchte wissen wie Ew Wohlgeboren es machen um im Laut
|10*| zB. {ṭa} und
{ta} zu unterscheiden.
Ueberhaupt möchte ich das Sanskrit die todteste aller todten Sprachen nennen. Denn ich habe in der dicken Grammatik von Wilkins auch nicht eine Zeile über den Accent gefunden, auf dem doch in der Sprache alles Leben, ja selbst alle Unterscheidung der Wörter, den Individuen der Sprachen, beruht. Was davon vorkommt ist nur immer Quantität. Drum gestehe ich, kann ich Ew Wohlgeboren nicht ganz darin beitreten, daß Sie die langen Vocale mit einem Accent, und nicht mit einem Längezeichen bezeichnen. Es kann den Leser misleiten, und ihm eine falsche Vorstellung geben.
Noch unbegreiflicher wird mir die Materie des Accents im
Sanscrit, wenn ich an das häufige
Coel***iren <|![]() Humboldt|
Coalesciren> |
Humboldt|
Coalesciren> |![]() Schreiber| zweier Wörter in Eins denke, was die
Schwierigkeiten des Verstehens so sehr vermehrt. Manchmal ist allerdings dies
Coelesciren <|
Schreiber| zweier Wörter in Eins denke, was die
Schwierigkeiten des Verstehens so sehr vermehrt. Manchmal ist allerdings dies
Coelesciren <|![]() Humboldt| Coalesciren> |
Humboldt| Coalesciren> |![]() Schreiber| nur Sache der Rechtschreibung und der
Sitte, so wie auch Ew Wohlgeboren in der Vorrede des
Nalus Sich so darüber auslassen, daß man
sieht, daß eine gewisse Willkühr darin liegt. Wenn zB. ein Wort mit einem
schweigenden Consonanten schließt, und das andre mit
einem Vocal anfängt, so wäre es zwar eine große
Erleichterung, wenn man, wie man nicht thut, die reell
getrennten Wörter auch im Schreiben trennte, allein man begreift doch, daß dies
im Accent nichts ändern kann, sondern daß jedes Wort den
seinigen behält. Allein wie mag es da gewesen seyn, wo End- und
Anfangsbuchstaben zusammen in einen dritten übergehen, oder sich auch sonst nur
ver-|11*|ändern? Sind da beide Worte unter Einem Accent gekommen, wie Ein Wort eigentlich immer nur Einen hat, oder
nicht? Eine accentlose Sprache läßt sich nicht denken.
Ist aber die Accentlehre im Sanskrit ganz untergegangen, oder existirt sie
in Unterweisungen, und wird nun, da sie zum Verständniß nicht hilft, übergangen?
Hierüber wünschte ich sehr durch Ew Wohlgeboren Aufklärung zu erhalten.
Schreiber| nur Sache der Rechtschreibung und der
Sitte, so wie auch Ew Wohlgeboren in der Vorrede des
Nalus Sich so darüber auslassen, daß man
sieht, daß eine gewisse Willkühr darin liegt. Wenn zB. ein Wort mit einem
schweigenden Consonanten schließt, und das andre mit
einem Vocal anfängt, so wäre es zwar eine große
Erleichterung, wenn man, wie man nicht thut, die reell
getrennten Wörter auch im Schreiben trennte, allein man begreift doch, daß dies
im Accent nichts ändern kann, sondern daß jedes Wort den
seinigen behält. Allein wie mag es da gewesen seyn, wo End- und
Anfangsbuchstaben zusammen in einen dritten übergehen, oder sich auch sonst nur
ver-|11*|ändern? Sind da beide Worte unter Einem Accent gekommen, wie Ein Wort eigentlich immer nur Einen hat, oder
nicht? Eine accentlose Sprache läßt sich nicht denken.
Ist aber die Accentlehre im Sanskrit ganz untergegangen, oder existirt sie
in Unterweisungen, und wird nun, da sie zum Verständniß nicht hilft, übergangen?
Hierüber wünschte ich sehr durch Ew Wohlgeboren Aufklärung zu erhalten.
Eine sonderbare Sitte ist es auch, das kurze i, und allein dieses unter allen Vocalen, vor den Consonanten zu schreiben, nach dem man es ausspricht.
Das ganze Kapitel des
sandʿi habe ich mit so vieler Genauigkeit als
möglich studirt. In
Wilkins sind aber die Regeln wenig geordnet,
ich möchte sie beinahe verwirrt nennen. Ich habe mir zu meinem Gebrauch sie ganz
umgearbeitet. Auch ist das Kapitel, wie man sieht, nicht recht vollständig.
Ueberhaupt wäre eine andre Grammatik ein großes
Bedürfniß.
Wilkins scheint mir unschätzbar, als ein
großes Repertorium von Wörtern und Paradigmen, allein die Leichtigkeit der Uebersicht, die Aufstellung
viele Fälle umfassender Regeln u. so. f. fehlt ganz. Die Declinationen sind unendlich leichter, als sie bei ihm scheinen. Die
von ihm verschmähte Tafel der Endungen (§ 69.) dient doch zu einer viel
faßlicheren Grundlage, als seine zahlreichen Paradigmen.
Ich komme durch die Declinationen viel besser durch,
wenn ich erstlich immer genau trenne, was wirklich veränderte Endung, und was
nur innerhalb des Wortes selbst vorgehende Umwandlung ist, und zweitens immer
mir anmerke, wo die Endung von jenem Grundschema
abweicht. Die CasusEndung, welche mit |12*| Consonanten beginnt {bha} und
{sa}, ist mir, auch wegen
ihrer Regelmäßigkeit sehr aufgefallen. Sollte sie nicht aus Praepositionen entstanden seyn? Sehr wunderbar und abweichend von
andern Sprachen ist auch der sogenannte crude state der
Wörter, von welchen der Nominatiuus hernach wieder
abweicht. In der 8 decl. ist dies vorzüglich häufig.
Sind diese Formen, als selbstständig, bloß abstrahirt
von den Fällen, wo sie, wie in einigen Gattungen der Composita, in undeclinirtem Zustand vorkommen,
oder haben sie einmal zur wirklichen Sprache gehört, so daß sie in ihrem rohem
Zustande mit in die Rede
eintreten? <|
![]() Humboldt| eintraten?>
Humboldt| eintraten?>
|![]() Schreiber| Sehr angezogen haben mich die Kapitel über die
Bildung der Derivativa. Aber ich dächte, daß auch diese
müßten befriedigender und systematischer gefaßt werden können.
Schreiber| Sehr angezogen haben mich die Kapitel über die
Bildung der Derivativa. Aber ich dächte, daß auch diese
müßten befriedigender und systematischer gefaßt werden können.
Ich studire, bis jetzt wenigstens, das Sanskrit bloß der Sprache, nicht der Literatur wegen, aber ich bin vollkommen überzeugt, daß es für jeden, der Sprachstudium treibt, ein unerläßliches Bedürfniß ist, es so tief, als nur immer die Umstände erlauben, zu kennen. Können mir daher Ew Wohlgeboren aus Ihrer eigenen Erfahrung Rathschläge geben, wie ich vielleicht mein Lernen noch zweckmäßiger einrichten kann, so werden Sie mich ungemein verbinden.
Den Brief an Herrn Vater habe ich besorgt. Den gegenwärtigen addressire ich an Ihren Herrn Vater nach Aschaffenburg.
Ich wünsche von Herzen, daß es Ihnen recht bald gelingen, oder vielmehr schon gelungen seyn möge, eine vortheilhafte Anstellung zu erhalten. Ich kann mir nicht denken, daß nach demjenigen, was Sie bereits geleistet haben, man Ihnen nicht damit entgegenkommen, und die Art selbst Ihrer Wahl überlassen sollte. Es wird mich sehr freuen, wenn Sie mir erlauben wollen, Ihnen manchmal zu schreiben, und wenn ich, wie bisher, auf Ihre gütigen und ausführlichen Antworten rechnen darf.
Berlin, den 4ten Januar, 1821.|Anhang|
|![]() Humboldt| Verzeihen Ew. Wohlgeb. daß ich nicht eigenhändig
geschrieben habe. Ich schreibe aber so schneller, u. dachte mir auch, daß es
Ihnen lästig seyn müßte, einen so langen Brief
in <von>
einer so undeutlichen Hand, als die meinige ist, zu lesen.
Humboldt| Verzeihen Ew. Wohlgeb. daß ich nicht eigenhändig
geschrieben habe. Ich schreibe aber so schneller, u. dachte mir auch, daß es
Ihnen lästig seyn müßte, einen so langen Brief
in <von>
einer so undeutlichen Hand, als die meinige ist, zu lesen.
Humboldt.