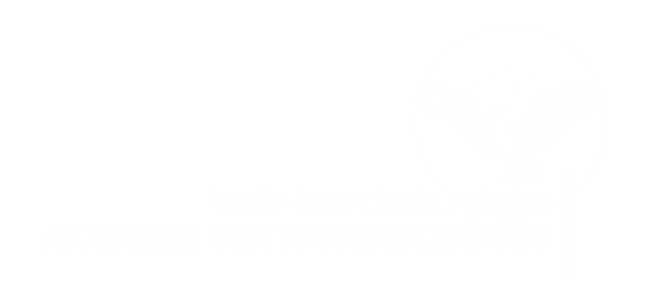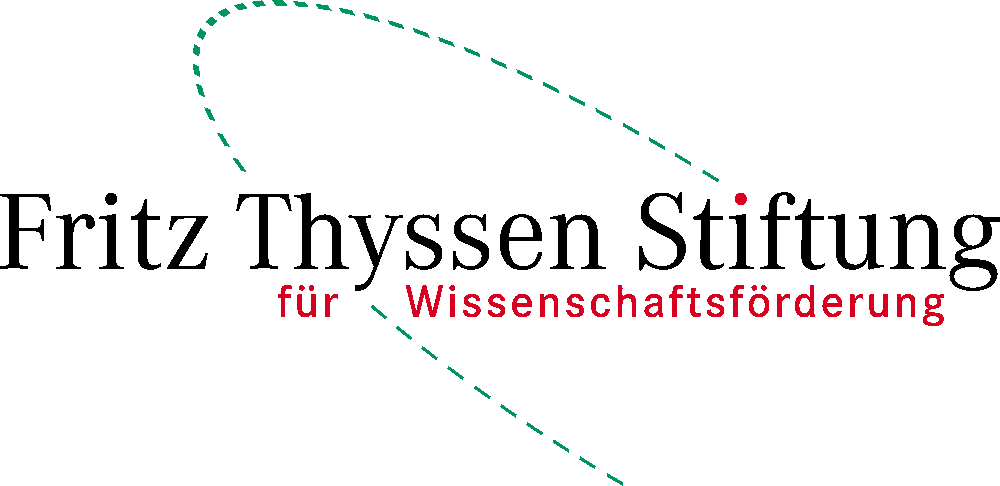Wilhelm von Humboldt an Christian Lassen, 16.05.1829
Ich kann Ew Wohlgebohren nicht lebhaft genug ausdrücken, welchen Gefallen nicht blos Sie mir erzeigt, sondern welchen wahren und großen Dienst Sie mir geleistet haben durch Ihren gütigen Brief vom 27.t Februar. c.[a] Denn die Sanskrit-Grammatiker mit ihrem Formelwesen sind mir noch verschlossene Schreine, und ich glaube, daß ich nie die Zeit gewinnen werde, mich in sie hineinzustudiren. Ich habe bewundert, wie vertraut Sie damit sein müssen, um so schnell alles über Ein Tempus im Panini Zerstreutes zusammenzufinden. Unter denen, die sich noch jetzt mit dem Sanskrit beschäftigen, sind Ew Wohlgebohren der einzige, der hierin tief eingegangen ist. Es wäre unendlich schade, wenn Sie diesen Vorzug nicht wirklich benutzten.
Da
Colebrooke sich wohl nicht geirrt hat, so
wird sich das Tempus mit der Reduplication wohl bei
andren Grammatikern finden.
Colebrooke nannte es bestimmt lot. {loṭ}å; let.
{leṭ} [b] war mir aus den englischen Grammatiken wohl bekannt. Es giebt einen (vielleicht
mehrere) eignen Tractat über die Grammatik der
Vedas. Wenn Ew Wohlgebohren nur einmal
diesen lesen und excerpiren könnten.
Obgleich das tempus let keine Reduplication hat, so sind die Formen desselben bei Panini mir doch von der größesten Wichtigkeit geworden.
Ich bin nämlich, seit vorigem Sommer, wo ich mich viel mit Betrachtung unsrer jetzigen Anordnung des Sanskrit Verbum beschäftigt habe, zu der Ueberzeugung gekommen, daß es ganz unrichtig ist (wenigstens einen andren Sinn als bei andren Sprachen hat) wenn man der Sanskrit-Conjugation 10 tempora und unter diesen 3 Praeterita beilegt, und wenn man das sogenannte Praet. 3. (Bopps vielförmiges, ein Name, der eigentlich von mir herstammt) für ein eignes Praeteritum hält, noch mehr wenn man es gar A rist |sic| nennt, und man glaubt, wie ein Griechisches[c], drei neben einander gebrauchte, in ihren Functionen eigenthümlich verschiedene Gattungen des Praeteritum zu besitzen, da das Praet. 3. höchstens so neben den andren steht, als der Aor. 2 neben dem Aor. 1. im Griechischen.
Meiner jetzigen Ansicht nach, ist das Praet. 3. nichts, als, wenn Sie mir den unedlen Ausdruck zu Gute halten, eine Art Polterkammer, in welcher die Grammatiker, von denen unsre Conjugationsanordnung herstammt, alle Formen zusammenwarfen, die sie außer den gewöhnlich dienenden, zwar selten, aber doch hier und da fanden, und die nur das mit einander gemein hatten, daß sie ein Augment und Vergangenheitsbedeutung an sich trugen. An sich waren diese Formen obsolet gewordene einer früheren Zeit.
Eine ganz ähnliche, nur ältere Polterkammer von Formen ohne Augment und wie ich glaube, mit Gegenwartsbedeutung, scheint mir das Tempus let. Es enthält aber blos Formen, die in den Schriften, aus welchen unsre Anordner excerpirten, nicht mehr vorkamen, sondern nur in den, von unsren Anordnern eigentlich ausgeschlossenen Vedas.
Irre ich mich nicht hierin, so sehen Sie, wie wichtig dies Tempus für meine Behauptung über das Praet. 3. ist.
Der kürzeste und directeste Beweis für meine Behauptung über das Praet. 3. ist mir aber die Thatsache, daß diese Formen so ungemein selten vorkommen.
Im ganzen Nalus finden sie sich nur von 5 Verben, nämlich von
|
|
8 mal, |
|
einmal, |
|
|
einmal, |
|
einmal, |
|
|
5 mal, |
also überhaupt nur 16mal in einem so langen Gedicht. Ich glaube genau gezählt zu
haben. Hätte ich mich aber auch um das Doppelte geirrt, so wäre der Gebrauch
immer sehr selten. Auch im Griechischen kommen zwar einige Tempora, wie das Plusquamperfectum, Paulo post futurum, selten vor. Allein theils nicht so
selten, theils ist der Begriff dieser tempora selbst ein
seltener. Allein der des Aorists findet sich auf jeder
Seite eines erzählenden Gedichts vielemale. In den von
Bopp gedruckten Episoden[d] ist das
Verhältniß ein ähnliches, wenn gleich die Formen andrer Verba hinzukommen, wie von {stu},
{vac},
{vadh},
{dā},
{jan},
{cch},
{bhī}. Doch bleiben
die im
Nalus vorkommenden fünf Verba immer die, deren Praet. 3. am häufigsten
wiederkehrt. Bei der großen Aehnlichkeit des Stils und der Sprache ist nicht zu
glauben, daß es in diesem ganzen altepischen Kreise anders seyn sollte. Die
Prosa des
Hitopadesa habe ich erst flüchtig hierauf
geprüft. Es ist mir aber beim Durchlaufen der ersten Hälfte nur Ein Beispiel,
das 3. Praet. von
{gam},
ich denke im 2. Buche, vorgekommen. Allein auch das 1 und 2 Praet. sind da minder häufig. Das herrschende Tempus ist das Praesens und die durch das Participium und das ausgelassene oder ausgedrückte Verbum-Subst. gebildeten Tempora.
Aus dem Allem ist mir klar, daß das Praet. 3 keines der
Tempora ist, die durch eine bestimmte grammatische
Bedeutung hervorgerufen werden. Hierzu hatte man zwei andre. Es war nur eins,
welches der Dichter entweder wegen der festen Gesetze des Metrum, oder wegen des Wohlklangs überhaupt, oder wegen der
Abwechslung und aus Neigung zu Archaismen aus seiner
halben Verschollenheit hervorzog. Daher stehen auch z. B. {agamat} und
{agacchat} immer in
bestimmten Stellen des Verses.
Die Grammatiker bilden freilich von jeder Wurzel ein Praet. 3. Es folgt aber darum[e] nicht, daß sie alle diese Formen aus Werken excerpirt hatten. Vieles mochten sie aus dem Volksgebrauch schöpfen. Auch im Deutschen sind: er buk, er boll bekannt, dürften aber in Büchern schwer aufzutreiben sein. Vielleicht hatten sie aber auch nur ältere grammatische Schriften vor sich, aus denen sie, wie wir aus ihnen, diese Bildungen abschrieben. Wer weniger säuberlich mit ihnen umginge, würde sagen, daß sie sie großentheils analogisch selbst formten.
So wäre also das 3. Praet. kein eignes Tempus der Conjugation, sondern eine Nebenform des 1. Praet. Den gleichen Fall finden wir beim 1. Fut. das auch selten erscheint.
Bei den einzelnen Formen des 3 Praet. habe ich noch eine
Meinung, die aber allerdings mehr Vermuthung ist. Die ganze Abtheilung in die 4
ersten und 6 letzten Tempora ist nur Werk der Grammatiker, und es ließe sich viel darüber sagen. Die
Form des 3 Praet. die nur einen Bindevocal {a} annimmt, aber
Guna und Nasale
verwirft, ist nichts als eine reine Fortsetzung der 6ten Classe. Ich glaube nun, daß es in dieser
natürlichsten und vermuthlich ursprünglichsten Verbalbildung, vermuthlich nach Dialecten
geschieden, zwei Conjugationsarten gab, eine mit
Guna, eine ohne. In unsrer Sanskritsprache hat die erstere die Oberhand behalten. Die 6. Cl. begreift nur wenig Wurzeln unter sich. Allein das
Praet. hat sich ohne
Guna bei den Grammatikern im Praet. 3. erhalten.
In dem let müssen nach Paninis Angaben zwei Formen gewesen sein, und eine dritte noch ist darin zu vermuthen.
Daß nicht einmal die Endungen in diesen let dieselben
sind, ist wunderbar. Diese Gleichheit der Endungen kann man aber wohl nur in
derselben Sprachepoche erwarten, und let mag Formen aus
verschiedenen enthalten. Ich glaube nicht, daß {dadat} grade Vergangenheitsendung hat. Ist doch das Praesens
amat (obgleich Ew Wohlgebohren mir
wahrscheinlich einwenden werden, daß diese Form gewöhnlich von
amati mit abgeschliffenem End-i abgeleitet wird) ebenso.
Der Vergangenheitsbegriff liegt im Augment und der Reduplication.
Die erste Form dieses let ist also in der Endung der 2.
Bildung des Praet. 3. (nach Bopp) gleich, hat aber i zum Bindevocal u. nimmt
die Vocalumbeugende Verstärkung an. {neṣat},
{tāriṣat}. Dahin gehört
auch wohl
{āmoṣai}, nur daß da die
Endung wieder verschieden ist.
Die zweite Form hat den Bindevocal {a} und verstärkt denselben regelmäßig vor der Pronominalendung so daß
{a} in
{ā} übergeht. Im Parasm. scheint mir Ew Wohlgebohren Paradigma ganz richtig durchgeführt. Es ist aber sehr merkwürdig hier
zu sehen, wie, was wir jetzt als für wesentlich halten, früher gar nicht so fest
bestimmt war. Bei uns gehört im Dualis u. 1. plur. das End-
{s} oder
{ḥ} ausschließlich
dem Praesens an, und fehlt den andren 3 ersten Tempora. Hier hat let beides.
Auch in Ihrem Paradigma würde ich dem Dual. durchaus diese Alternative geben. Unser Imperativ ist in 1. pers. parasm. ganz aus dem
let erklärbar. Denn
{karavāvaḥ} führt im Sing. auf
{karavāmi}, was nur
phonetisch von
{karavāni} sich
unterscheidet.
Vom Atmanepadam dieser zweiten einfachen Form hat
Panini
bloß 1. sing. 2. 3. dual. und 3. Plur. Auch diese Formen zeigen
deutlich den Bindevocal {a} der ersten
Classe und dessen Verstärkung vor der Pronominalendung. Denn
{pataite}, was Ew
Wohlgebohren ganz richtig nach
Paninis
{karavaite} bilden, ist doch
wohl nur erklärbar durch
{patete} der 1. Cl. was durch Verstärkung zu
{pataite} wird. Die Verstärkung geschieht hier durch
Wriddhi, da ein
Wriddhi-fähiger Vocal
da ist, sonst durch Verlängerung des
{a}, die,
glaube ich, bei den Grammatikern nicht auch
Wriddhi heißen sollte, da
Guna und
Wriddhi das Zusammenfließen unähnlicher Vocale voraussetzen. Bei dieser Verstärkung fällt mir
ein, daß wir vielleicht Unrecht haben, die Verlängerung des
{a} vor
{v} u.
{m} in unsrer Conjugation dem Einfluß dieser Buchstaben zuzuschreiben.
Diese Formen sind eher Ueberreste früherer, sich im let
zeigender Conjugationsart. Das
{āni} des Imperativi scheint diese Meinung zu
begünstigen.
Ob man, wie Ew Wohlgebohren gethan haben, allen von
Panini nicht angeführten Endungen die
Endung {ai} geben muß,
bleibt zweifelhaft. Es ist wohl anzunehmen, u. durch das Atman. praes. angezeigt, daß ursprünglich alle Personen eines Tempus in demselben Vocal
auslauten. Wir sehen aber in let schon eine Ausnahme in
2. 3. dual.
Sehr merkwürdig sind die Formen {karavaithe} u. s. f. Die 8. Cl. hat hier, gegen die
heutige Regel, auf die also auch nicht so fest zu bauen ist, in 2. 3. dual. Atman. Guna
. Damit ist aber der Bindevocal der 1. Cl.
verbunden. Denn an sich gäbe die 8. Cl. gunisirt nur
{karavāthe} wie, ohne
Guna
{kurvāthe}. Aus dem letzteren könnte aber nicht
{karavaithe} entstehen, welches offenbar
{karavethe}
wriddhisirt ist.
So zeigt dies let in vielen Punkten, daß mehrere unsrer heutigen Conjugationsregeln keine innerlich bedingte Nothwendigkeit, sondern nur einen historischen, zufälligen Grund haben.
Eine dritte Form (nämlich Endungen des 1. Praet. ohne
eingeschobenen Zischlaut) geben {dadāt} und
{dadat}, und in ihr
liegen wieder zwei mit und ohne Vocalverstärkung.
Sollte nicht in dem {upasaṃvādāśaṃkayośca} bei
Panini
ein Druckfehler statt
{upasaṃvādha} cet. seyn?
{rārandhi} halten Ew
Wohlgebohren doch wohl auch für eine, nur etwas anomal
gebildete Intensivform. Der lange Vocal in der Reduplicationssylbe scheint es mir zu beweisen, da das
Sanskrit, außer den Intensivformen, nur mit kurzem
Vocal reduplicirt, die einzige 7.
Farmation |sic| des 3. Praet. ausgenommen.
In nr. 73. 74. der Jahrbücher für wissenschaftliche
Kritik d. J. werden Ew Wohlgebohren einen kleinen
Aufsatz von mir über die Worttrennung im Sanskrit finden, den ich Ew Wohlgebohren, und Herrn v. Schlegels
gütiger Nachsicht empfehle. Ich schmeichle mir mit der Hoffnung, daß keiner von
Ihnen darin einen Angriff auf den Druck Ihres
Ramayana sehen wird. Ich bin zwar von der
Richtigkeit meiner Meinung fest überzeugt, und habe sogar Einiges nicht
angeführt, was sich wohl noch gegen die Schreibung, welche die Engländer
eingeführt haben, einwenden läßt. So schreiben diese {vanāt}
{tasmāt}: Wollte man aber
consequent alle Wörter zusammenziehen, wo End- u. Anfangsbuchstaben einander
affiziren, so müßte man es auch mit diesen thun. Denn das Anfangs-
{t} des zweiten ist
der einzige Grund, warum das End-
{t} des ersten sich
unverändert erhält. Ich fühle aber sehr gut, daß man auch einer andren Meinung
sein kann, und daß, selbst wenn man es nicht wäre, man es praktisch besser
finden kann, bei einer nun einmal eingeführten Gewohnheit zu bleiben. Wahr ist
es indeß freilich, daß
Schlegels Ansehen und Gewicht, wenn er
meine Theorie für richtig hält, und ein Werk, wie diese
herrliche Ausgabe des
Ramayana, die Sache auf einmal für immer für
Deutschland festgestellt haben würden, und dann wäre nach und nach auch das
Ausland gefolgt.
Ich habe mit dem größesten Interesse und Vergnügen die Vorrede zum Ramayana gelesen, die Herr v. Schlegel meinem Bruder geschickt hat. Die Geschichte, welche darin von der Behandlung des Textes des Ramayana gegeben wird, ist vortreflich. Es ist das erstemal, daß die Fackel der Kritik in das Gebiet der Sanskrit-Literatur wahrhaft getragen wird. Sehr gut ist es auch, daß Schlegel in der Benutzung der beiden hauptsächlich verschiedenen Texte des Gedichts nicht einem steifen Princip gefolgt ist, sondern seinem kritischen Gefühl und seinem Geschmack die Entscheidung erlaubt hat. Er kann beiden so sicher vertrauen; und da seine Ausgabe erst den Ramayana unter uns bekannt machen wird, so wird das Gedicht nun so bleiben und auf die Nachwelt übergehen, wie er es festgestellt hat. Außer dem reichen Gehalt dieser Vorrede habe ich auch die meisterhafte Behandlung des Römischen Ausdrucks darin bewundert. Es ist unendlich selten, daß in einer ächten und classischen Latinitaet sich zugleich in diesem Grade die Individualitaet des modernen Schriftstellers und seines Zeitalters erhält. Erstaunt bin ich über die Menge der verglichenen Handschriften. Wenn man die Mühsamkeit solcher Vergleichungen nur einigermaßen kennt, scheint es eine wahre Riesenarbeit.
|![]() Humboldt| Ich habe mich einer fremden Hand bedient, um Ew.
Wohlgeboren nicht mit der Entzifferung meiner unleserlichen beschwerlich zu
fallen. Die Verspätung meiner Antwort halten Sie mir gewiß zur Gute. Ich habe
seit dem Empfang Ihres Schreibens mich in einer so traurigen und mein ganzes
Gemüth so aufregenden Lage befunden, daß ich kaum jetzt noch zu einem
freien|?| u. nicht innerlich gestörten Arbeiten mich zu
sammlen fähig bin.
Humboldt| Ich habe mich einer fremden Hand bedient, um Ew.
Wohlgeboren nicht mit der Entzifferung meiner unleserlichen beschwerlich zu
fallen. Die Verspätung meiner Antwort halten Sie mir gewiß zur Gute. Ich habe
seit dem Empfang Ihres Schreibens mich in einer so traurigen und mein ganzes
Gemüth so aufregenden Lage befunden, daß ich kaum jetzt noch zu einem
freien|?| u. nicht innerlich gestörten Arbeiten mich zu
sammlen fähig bin.
Humboldt
Tegel bei Berlin, den 16. Mai, 1829.
Fußnoten
- a |Editor| Ein Brief dieses Datums ist von Lassen nicht erhalten; der letzte Brief stammt vom 16. Februar 1829 (jedoch gibt es einen Brief Bopps vom 27. Februar 1829). Inhaltlich bezieht sich dieser Brief auf die im Schreiben vom 16. Februar abgehandelten Sachverhalte. [FZ]
- b |Editor| Die an dieser Stelle fehlenden Devanagari-Worte sind aus dem eigenhändigen Konzept (Krakau, Coll. ling. fol. 21, Bl. 120–123) eingefügt.
- c |Editor| Im Konzept heißt es: „wie im Griechischen“.
- d |Editor| Ist damit Ardschuna’s Reise oder Die Sündflut gemeint?
- e |Editor| Im Konzept: „daraus“.