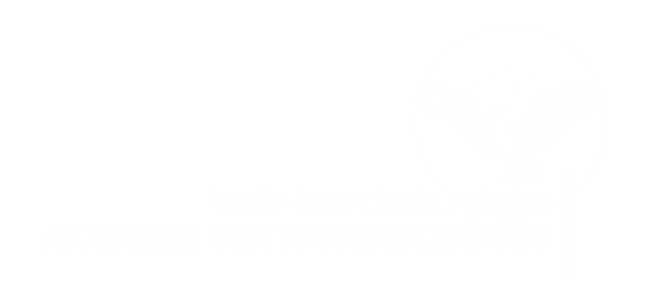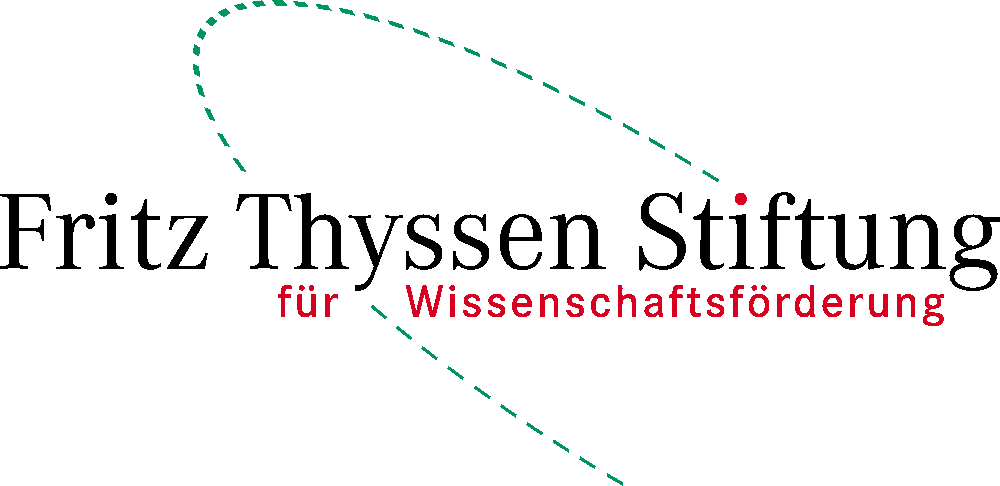Wilhelm von Humboldt an Maximilian Friedrich Christian Schmidt, 28.10.1826
|60r|An Herrn Oberlehrer Dr:
Schmidt
Wohlgeboren
in Ratibor.
Tegel, den September <|
Ich bat Euer Wohlgeboren in meinem letzten Brief um Erlaubniß, Ihnen noch
ausführlich über Ihre gehaltvolle Schrift[a] schreiben zu dürfen, und
schiebe dies um so weniger auf, als ich dieselbe eben wieder vollständig und
genau
durchgesehen
<|![]() Humboldt| durchgelesen>
habe.
Humboldt| durchgelesen>
habe.
Ich habe mich auf’s Neue an dem belehrenden Reichthum scharfsinniger Bemerkungen erfreut, den Euer Wohlgeboren mit einer interessanten Auswahl von Stellen, welche eine ausgebreitete und sorgfältig benutzte Belesenheit in den alten Schriftstellern beweißt, |sic| über den Theil der Grammatik und vorzüglich der Syntaxis, in welcher der Infinitiv einschlägt, zusammen gestellt haben.
Ihre Abhandlung muß schon dadurch jeden, der sich mit
Sprachstudium beschäftigt, um so wichtiger werden, als Sie überall auch aus
andern Sprachen Beweise herbeibringen, und ihre verschiedene Constructionsart
vergleichen. Ich übergehe indeß diesen ganzen Theil, und wende mich
nun
<|![]() Humboldt| nur>
zu demjenigen, gegen den ich wünschte, Ihnen meine abweichende Meinung
vorzutragen. Die Punkte, über die wir verschiedenen Ansichten |60v|
folgen, beruhen auf so feinen, ja ich möchte sagen, spitzigen Gründen, daß man
sehr leicht darüber immer uneins bleiben kann, aber sie berühren auch sehr nahe
die ersten Grundsätze der Grammatik, und schon darum, wenn es nicht überhaupt
immer angenehm wäre, seine Ideen da gegenseitig auszutauschen, wo allein das
reine Interesse an der zu suchenden Wahrheit vorwaltet, scheint es mir
wichtiger, den Gegenstand noch einmal zur Sprache zu bringen.
Humboldt| nur>
zu demjenigen, gegen den ich wünschte, Ihnen meine abweichende Meinung
vorzutragen. Die Punkte, über die wir verschiedenen Ansichten |60v|
folgen, beruhen auf so feinen, ja ich möchte sagen, spitzigen Gründen, daß man
sehr leicht darüber immer uneins bleiben kann, aber sie berühren auch sehr nahe
die ersten Grundsätze der Grammatik, und schon darum, wenn es nicht überhaupt
immer angenehm wäre, seine Ideen da gegenseitig auszutauschen, wo allein das
reine Interesse an der zu suchenden Wahrheit vorwaltet, scheint es mir
wichtiger, den Gegenstand noch einmal zur Sprache zu bringen.
Ich werde dabei eigentlich mehr Bernhardi, als mich, zu vertheidigen haben. Denn die Zweifel, die ich Euer Wohlgeboren vortragen möchte, betreffen, noch außer der Streitfrage über den Infinitiv, Ihre Theorie der momentanen Merckmale |sic| und der Satzbildung überhaupt, so wie das, was Sie über die tempora sagen. Allein auch in Absicht des Infinitivs ist Bernhardi, wenn er ihn gleich ein Substantivum nennt, dennoch mehr meiner, als Euer Wohlgeboren Meinung. Denn er befaßt (§ 64. N°., 5) den Infinitiv unter das Verbum, wie Sie (§ 20) nicht zu thun geneigt sind, und nennt ihn, ungeachtet er ihn zum Verbal-Substantiv |61r| macht, (§ 47 Nr 1) ein Mittelglied zwischen dem Participium und Substantiv, was ich nicht logisch richtig finden kann. Denn wenn das Verbal-Substantiv nur Mittelglied, also Annäherung zum Substantiv ist, so muß es auch vom Substantiv selbst ausgeschlossen werden.
Dem Begriff des Participiums den des momentanen Merkmals unterzuschieben, scheint mir, wenn ich Meinung frei sagen soll, nicht zulässig, vielmehr der philosophischen Herleitung des Begriffs des verbum und der ganzen Bildung des Satzes wesentlich entgegenzustehen.
Zuerst bestimmt der Ausdruck momentan, dem dauernden entgegengesetzt, durchaus nicht das, was wesentlich im Participium liegt, sondern begreift, streng genommen, auch bloße Adjectiva unter sich. Denn ist nicht das Grün der Blätter ein andauerndes und momentanes Merkmal, da sie im Herbste gelb sind? und doch ist hier aller Begriff von verbum und Participium entfernt. Doch will ich hierauf kein Gewicht legen. Aber auf jeden Fall vermisse ich in Ausdruck und Begriff die Schärfe, die klar und rein das Wesen des Participiums anzeigt. Euer Wohlgeboren nennen momentanes Merkmal das-|61v|jenige, was man sich nur als vorübergehend an einer Sache denkt. Hierbei bleibt man nun ungewiß, ob das Characteristische dieser Merkmale in der Zeit ihrer Dauer, oder darin liegt, daß sie eine Energie (Handeln, Leiden, sich befinden) sind. Es scheint sogar, als erklärten Sie Sich für das Erstere, da Sie (S. 6) die Thätigkeit nur erst an die Zeit anknüpfen.
Hieraus entsteht nun aber, meiner Meinung nach, eine wahre Verdunkelung des
scharf aufzufassenden Begriffs
eines Participiums.
<|![]() Humboldt| der Participien.>
Denn das Characteristische dieser liegt gerade in der Energie, und die
Zeit knüpft sich nur an diese an. Ja, genau genommen, ist es nicht einmal die
Zeit, insofern sie aus Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft besteht, welche beim
Participium mitgedacht wird. Es sind nur die
darin
<|
Humboldt| der Participien.>
Denn das Characteristische dieser liegt gerade in der Energie, und die
Zeit knüpft sich nur an diese an. Ja, genau genommen, ist es nicht einmal die
Zeit, insofern sie aus Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft besteht, welche beim
Participium mitgedacht wird. Es sind nur die
darin
<|![]() Humboldt| drei>, bei jeder Energie
nothwendig zu unterscheidenden Punkte, die aber freilich successiv, also in der
Zeit wirklich werden, wie Bernhardi mir
sehr gut (§ 43 N° 8) zu beweisen scheint. Jene als
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gedachte Zeit gehört der Copula an, und bei Euer Wohlgeboren Begriff eines momentanen Merkmals
entsteht nun wieder, wenn ich nicht ganz irre, daraus eine Verlegenheit, daß
dieselbe |62r| gleichsam alle Zeit an sich reißt, ein Chl** was vorzüglich bei der Erörterung der
tempora sichtbar wird. Ueberhaupt hätte ich
gewünscht, Euer Wohlgeboren hätten sich auch über die Copula erklärt. Soll diese nichts als das Gleichheitszeichen der
Mathematik sein, so kommt, wie es mir scheint, niemals ein Satz zu Stande. Ist
sie aber das
synresirende
<|
Humboldt| drei>, bei jeder Energie
nothwendig zu unterscheidenden Punkte, die aber freilich successiv, also in der
Zeit wirklich werden, wie Bernhardi mir
sehr gut (§ 43 N° 8) zu beweisen scheint. Jene als
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gedachte Zeit gehört der Copula an, und bei Euer Wohlgeboren Begriff eines momentanen Merkmals
entsteht nun wieder, wenn ich nicht ganz irre, daraus eine Verlegenheit, daß
dieselbe |62r| gleichsam alle Zeit an sich reißt, ein Chl** was vorzüglich bei der Erörterung der
tempora sichtbar wird. Ueberhaupt hätte ich
gewünscht, Euer Wohlgeboren hätten sich auch über die Copula erklärt. Soll diese nichts als das Gleichheitszeichen der
Mathematik sein, so kommt, wie es mir scheint, niemals ein Satz zu Stande. Ist
sie aber das
synresirende
<|![]() Humboldt| synthesirende>
Seyn, so wird man, dünkt mich, von selbst darauf geführt, das momentane
Merkmal in ein wahres energisches Participium
umzuschaffen.
Humboldt| synthesirende>
Seyn, so wird man, dünkt mich, von selbst darauf geführt, das momentane
Merkmal in ein wahres energisches Participium
umzuschaffen.
In Bernhardi’s Definition ist dagegen das
Participium in seinem eigentlichen Wesen aufgefaßt,
und vielleicht ist nur sein Ausdruck in § 40 Nr 7 zu
tadeln, wobei ich jedoch bemerken muß, daß derselbe in der Citation in Ihrer Abhandlung (S. 6. Z. 8)
durch den Druckfehler eines ausgelassenen Commas
zwischen kräftig und wirkend, unangemessener erscheint, als bei ihm, wo er sagt: sind kräftig, wirkend u. s. f. Er hätte bei den
Worten: energisch, sich bewegen stehen bleiben sollen, und hinzusetzen, daß das
Leiden ebenso eine Bewegung im Leidenden erheischt, der ja das Leiden ertragen,
d. h. gegenwirken muß. Im Grunde ist das aber nicht nothwendig. Denn das part. pass.
|62v|
drückt
<|![]() Humboldt| deutet>
ja ebenso gut eine Handlung aus, nur von Seiten dessen, auf den sie
geschieht. Auch die verba, wie ἰσάζειν, albere. bilden, dünkt mich, gar keine Ausnahme, sie sind nur
Metaphern, wie die Sprache so viele hat. Das Adjectivum
gleich wird, als wäre es eine Handlung des
Gegenstandes, in das Participium
gleichsam umgebildet, und so entstehen mit dem Begriff
des Seyns jene verba. Auch scheint Bernhardi selbst den Zweifel, den er in der
1801 erschienenen Sprachlehre hierüber hatte, 1805.
aufgegeben zu haben, da er in den in diesem Jahre herausgegebenen Anfangsgründen bei seiner ersten Definition bleibt.
Humboldt| deutet>
ja ebenso gut eine Handlung aus, nur von Seiten dessen, auf den sie
geschieht. Auch die verba, wie ἰσάζειν, albere. bilden, dünkt mich, gar keine Ausnahme, sie sind nur
Metaphern, wie die Sprache so viele hat. Das Adjectivum
gleich wird, als wäre es eine Handlung des
Gegenstandes, in das Participium
gleichsam umgebildet, und so entstehen mit dem Begriff
des Seyns jene verba. Auch scheint Bernhardi selbst den Zweifel, den er in der
1801 erschienenen Sprachlehre hierüber hatte, 1805.
aufgegeben zu haben, da er in den in diesem Jahre herausgegebenen Anfangsgründen bei seiner ersten Definition bleibt.
Ich bin nun zwar gar nicht der Meinung, daß man schlechterdings hier Bernhardis Behauptungen ängstlich folgen müsse. Wäre eine andere Art der Darstellung lichtvoller oder bestimmter, so würde ich sie mit Freuden ergreifen. Allein in Ihrer Herleitung durch den Begriff eines momentanen Merkmals scheint mir das, was die Hauptsache beim Participium ist, daß gehandelt wird, in den Schatten gestellt, und der Begriff der Zeit, der nur insofern in das Participium kommen darf, als er von jener Haupt-|63r|sache gefordert wird, als das Wesentliche, und unabhängig von jener Beschränkung, hineingebracht zu sein. Ich will auf keine Weise läugnen, daß man den Begriff von allem dem, was nicht wesentlich zum Participium gehört, reinigen kann; dann wird er aber auch auf dasselbe mit der Bernhardischen Definition hinauskommen, und momentan und vorübergehend sind, meinem Gefühl nach, immer zu sehr zwischen bloßer successiver Abwechslung und wirklicher Handlung schwankende Begriffe.
Die Sprache ist doch nichts als ein Bild der Wirklichkeit, wie wir sie in uns aufnehmen. Nun aber ist Alles, was wir sehen oder erfahren Substanz, (Sache) oder Beschaffenheit, oder Handlung im weitläuftigsten Sinne des Worts. Das Handelnde ist sichtbar das Participium und nachher verbum. Jede Handlung ist nun allerdings momentan und vorübergehend, aber dies möchte ich nur Nebensache in ihr nennen. Die Hauptsache ist, so wie im verbum, die Kraftäußerung. Das Vorübergehende läßt sich aus dieser natürlich herleiten und bestimmen, allein die Kraftäußerung aus dem Vorübergehenden nicht mit gleich gebie-|63v|tender Nothwendigkeit.
Dieß hat nun auch auf den Begriff des Infinitivs einen unverkennbaren Einfluß, da derselbe ganz eigentlich nichts anders enthält, als die specifische Kraftäußerung des verbum, verbunden mit der Richtung derselben, und ihrer Bestimmung auf einen Zeitpunkt oder Zeitraum.
Daß der Begriff des Infinitivs in seiner reinen Form, wie
Euer Wohlgeboren § 9 sagen, zu einem abgeschlossenen
Ganzen zusammengefaßt werde, ist das, was ich eben läugnen muß.
Es
<|![]() Humboldt| Er>
scheint mir kein Substantivum eben darum, weil
in ihm die Verknüpfung zur Einheit fehlt, die
Bernhardi mit Recht, wie auch Sie ihm
beistimmen, im Substantivum fordert. Wenn ich sage: ich
sehe den Menschen gehen, sondere ich allerdings das Merkmal des Gehens von dem
Menschen ab, allein ich füge nicht den zweiten zur Bildung eines Substantivum nothwendigen Act,
das Zusammenfassen dieses Merkmals in eine Einheit, hinzu. Dies thue ich
dagegen, wenn ich sage: ich sehe das Gehen (den Gang) des Menschen. Jedes Substantivum muß immer auf eine Substanz
|64r| hinauskommen. Damit fängt auch Bernhardi seine Erklärung des Substantivs (§ 35 Nr 1) an. Nun aber sträubt
sich, wie gern ich meine Ansicht gegen die von Euer Wohlgeboren aufgeben möchte,
durchaus mein Gefühl dagegen, in den Worten: ich will essen, das letzte, als
eine Substanz anzusehen. Es enthält gar nichts, was
nicht schon im Attributivum lag, aber es ist ihm das,
was das Attributivum zu solchem macht, das Ankleben an
einer Substanz genommen. Euer Wohlgeboren nennen S. 9 diese Vorstellungsart verwerflich, weil sich logisch
dafür kein <|
Humboldt| Er>
scheint mir kein Substantivum eben darum, weil
in ihm die Verknüpfung zur Einheit fehlt, die
Bernhardi mit Recht, wie auch Sie ihm
beistimmen, im Substantivum fordert. Wenn ich sage: ich
sehe den Menschen gehen, sondere ich allerdings das Merkmal des Gehens von dem
Menschen ab, allein ich füge nicht den zweiten zur Bildung eines Substantivum nothwendigen Act,
das Zusammenfassen dieses Merkmals in eine Einheit, hinzu. Dies thue ich
dagegen, wenn ich sage: ich sehe das Gehen (den Gang) des Menschen. Jedes Substantivum muß immer auf eine Substanz
|64r| hinauskommen. Damit fängt auch Bernhardi seine Erklärung des Substantivs (§ 35 Nr 1) an. Nun aber sträubt
sich, wie gern ich meine Ansicht gegen die von Euer Wohlgeboren aufgeben möchte,
durchaus mein Gefühl dagegen, in den Worten: ich will essen, das letzte, als
eine Substanz anzusehen. Es enthält gar nichts, was
nicht schon im Attributivum lag, aber es ist ihm das,
was das Attributivum zu solchem macht, das Ankleben an
einer Substanz genommen. Euer Wohlgeboren nennen S. 9 diese Vorstellungsart verwerflich, weil sich logisch
dafür kein <|![]() Humboldt| Substrat>[b] finden lasse. Ich habe auf diese Einwendung (S. 84. Anm) selbst aufmerksam gemacht. Allein ich glaube
noch heute keine
Wiederlegung
<|
Humboldt| Substrat>[b] finden lasse. Ich habe auf diese Einwendung (S. 84. Anm) selbst aufmerksam gemacht. Allein ich glaube
noch heute keine
Wiederlegung
<|![]() Humboldt| Widerlegung>
darin zu finden. Der Infinitiv ist die
Darstellung des reinen Bewegens in der Zeit, er gehört gar nicht zu der Gattung,
welche sich durch die Eintheilung in Substanz und Attribut erschöpfen läßt.
Humboldt| Widerlegung>
darin zu finden. Der Infinitiv ist die
Darstellung des reinen Bewegens in der Zeit, er gehört gar nicht zu der Gattung,
welche sich durch die Eintheilung in Substanz und Attribut erschöpfen läßt.
Euer Wohlgeboren nennen den Infinitiv ein Abstractum, Bernhardi trennt ihn grade von diesem
fein
<frei>
geschaffenen Substantivum (§
45 Nr 10) Ich kann mich nicht enthalten, hierbei eine Bemerkung zu
machen, die in meiner Abhandlung nicht vorkommt. Dem
Begriff und |64v| der Sache nach, möchte ich den Infinitiv eher eine bloße, allgemein und
****
<|![]() Humboldt| vage>
ausgedrückte Wahrnehmung nennen. Hitze ist
ein Abstractum , heißes Eisen
zusammenzufügen, ist schon bestimmte Sprachart, aber Eisen
heiß zu sagen ist der unmittelbare und unverbundene Ausdruck der
Wahrnehmung. Wie nun da heiß steht, so scheint mir der
Infinitif |sic| zu sein, nicht das Abstractum des Participiums ,
sondern der Stoff, aus dem es erst künstlich gebildet wird. Daher sagen die
Kinder, wie auch Euer Wohlgeboren anführen, anfangs alles im Infinitiv.[c] Die Chinesische Sprache kennt, meiner
Ansicht nach (obgleich unsere Chinesischen Grammatiken es anders nehmen) vom
ganzen Verbum nichts, als diesen Infinitiv. Im
Sansscrit
<Sanscrit>
sind alle Wurzelwörter der verba
dá,
vá u. s. f. wirkliche Infinitive, nur daß sie in der verbundenen Rede[d] nicht vorkommen. Aber sie bezeichnen
Handlungen, und tragen gar keine Art der Bestimmung an sich. In einigen
Amerikanischen Sprachen kann man Substantiva und verba an sich nur nach ihrer Bedeutung unterscheiden,
aber beide untermischt gebrauchen und durch |65r| Hinzufügung gewisser
Partikeln zu diesen oder jenen stempeln. Man könnte dies allerdings einen
vorgrammatischen Zustand nennen, allein auch in unserer gebildetsten
Sprachen |sic| kann ich im wahren Infinitiv
nicht mehr sehen. Es scheint damit nun im Widerspruch zu stehen, daß der reine
Infinitiv eigentlich nur in wenig Sprachen vorhanden
ist, und die ungebildeten Sprachen, namentlich die Amerikanischen<,> so
große Schwierigkeit finden, Redensarten in denen er vorkommt, nachzubilden.
Diese Schwierigkeit aber ist mehr eine syntaktische, da
nun
<|
Humboldt| vage>
ausgedrückte Wahrnehmung nennen. Hitze ist
ein Abstractum , heißes Eisen
zusammenzufügen, ist schon bestimmte Sprachart, aber Eisen
heiß zu sagen ist der unmittelbare und unverbundene Ausdruck der
Wahrnehmung. Wie nun da heiß steht, so scheint mir der
Infinitif |sic| zu sein, nicht das Abstractum des Participiums ,
sondern der Stoff, aus dem es erst künstlich gebildet wird. Daher sagen die
Kinder, wie auch Euer Wohlgeboren anführen, anfangs alles im Infinitiv.[c] Die Chinesische Sprache kennt, meiner
Ansicht nach (obgleich unsere Chinesischen Grammatiken es anders nehmen) vom
ganzen Verbum nichts, als diesen Infinitiv. Im
Sansscrit
<Sanscrit>
sind alle Wurzelwörter der verba
dá,
vá u. s. f. wirkliche Infinitive, nur daß sie in der verbundenen Rede[d] nicht vorkommen. Aber sie bezeichnen
Handlungen, und tragen gar keine Art der Bestimmung an sich. In einigen
Amerikanischen Sprachen kann man Substantiva und verba an sich nur nach ihrer Bedeutung unterscheiden,
aber beide untermischt gebrauchen und durch |65r| Hinzufügung gewisser
Partikeln zu diesen oder jenen stempeln. Man könnte dies allerdings einen
vorgrammatischen Zustand nennen, allein auch in unserer gebildetsten
Sprachen |sic| kann ich im wahren Infinitiv
nicht mehr sehen. Es scheint damit nun im Widerspruch zu stehen, daß der reine
Infinitiv eigentlich nur in wenig Sprachen vorhanden
ist, und die ungebildeten Sprachen, namentlich die Amerikanischen<,> so
große Schwierigkeit finden, Redensarten in denen er vorkommt, nachzubilden.
Diese Schwierigkeit aber ist mehr eine syntaktische, da
nun
<|![]() Humboldt| nur>
der Infinitiv so gestellt werden soll, daß
seine Abhängigkeit sichtbar wird, und die Redeverbindung ist gerade das, worin
diese Völker am meisten zurück sind. Wo es auch einmal ein flectirtes Verbum giebt, da wird es schwer, es wieder von aller flexion zu entblößen, und es doch noch in der verbal form, abgesondert vom Substantiv , festzuhalten. Da tritt wirklich die Nothwendigkeit einer
Abstraction ein. Aber sehr für meine Ansicht spricht
es, daß, wie ich auch angeführt, gerade diese, sich ihrem natürlichen Gefühle
überlassenden Volkerstämme mehr Verbal- als Substantiv-Formen zu Surrogaten des Infinitivs gebrauchen. |65v| Es ist zwar unläugbar, daß, wie
Euer Wohlgeboren S. 8 sagen, jeder regierende Theil
eines Satzes, für sich allein genommen, einen unvollständigen Begriff giebt.
Allein da sich hierin doch Grade unterscheiden lassen, so scheint mir der Infinitiv ganz unvergleichbar enger, als ein Nomen, mit
dem Worte, von dem er abhängig ist, zusammen zu gehören.
Humboldt| nur>
der Infinitiv so gestellt werden soll, daß
seine Abhängigkeit sichtbar wird, und die Redeverbindung ist gerade das, worin
diese Völker am meisten zurück sind. Wo es auch einmal ein flectirtes Verbum giebt, da wird es schwer, es wieder von aller flexion zu entblößen, und es doch noch in der verbal form, abgesondert vom Substantiv , festzuhalten. Da tritt wirklich die Nothwendigkeit einer
Abstraction ein. Aber sehr für meine Ansicht spricht
es, daß, wie ich auch angeführt, gerade diese, sich ihrem natürlichen Gefühle
überlassenden Volkerstämme mehr Verbal- als Substantiv-Formen zu Surrogaten des Infinitivs gebrauchen. |65v| Es ist zwar unläugbar, daß, wie
Euer Wohlgeboren S. 8 sagen, jeder regierende Theil
eines Satzes, für sich allein genommen, einen unvollständigen Begriff giebt.
Allein da sich hierin doch Grade unterscheiden lassen, so scheint mir der Infinitiv ganz unvergleichbar enger, als ein Nomen, mit
dem Worte, von dem er abhängig ist, zusammen zu gehören.
Es liegt dies auch darin, daß nicht bloß der regierende Theil des Satzes
unvollständig ist, sondern der Infinitiv, seiner Natur
nach, gar nicht dem Geiste, auf ihn, wie doch auf
eine Substanz,
<|![]() Humboldt| einer Substanz möglich ist,>
zu ruhen erlaubt. Dieser Unterschied zwischen Substantivum und Infinitiv zeigt sich auch
darin, daß gewisse Wörter, wie müssen , dürfen , können gar nicht
ein Substantiv , als regiert, nach sich nehmen können.
Sie verbinden sich auf diese Weise, außer dem Infinitif |sic|, bloß mit Pronomina und
einigen dieser gleich kommenden Adjectiven (wie Alles, Einiges u. s. f.) und
thun dies letztere vermuthlich nur deshalb, weil dabei immer ein nur
ausgelassener Infinitit |sic| mitverstanden werden
kann.
Humboldt| einer Substanz möglich ist,>
zu ruhen erlaubt. Dieser Unterschied zwischen Substantivum und Infinitiv zeigt sich auch
darin, daß gewisse Wörter, wie müssen , dürfen , können gar nicht
ein Substantiv , als regiert, nach sich nehmen können.
Sie verbinden sich auf diese Weise, außer dem Infinitif |sic|, bloß mit Pronomina und
einigen dieser gleich kommenden Adjectiven (wie Alles, Einiges u. s. f.) und
thun dies letztere vermuthlich nur deshalb, weil dabei immer ein nur
ausgelassener Infinitit |sic| mitverstanden werden
kann.
In Absicht des Artikels glaube ich keine Inconsekuenz |sic| zu begehen, wenn ich sage, daß er beim Nomen, als bestimmter, im Gegensatz des unbestimmten, beim Infi-|66r|nitiv als Kennzeichen, daß er substantvirt wird, steht. In dem einen oder anderen Fall thut er, auch meiner Meinung nach, dasselbe, er bestimmt; daß aber sein Bestimmen verschieden wirket, liegt in der Natur des Nomen und Infinitivs. Das Nomen kann unbestimmt (Menschen) und bestimmt (der Mensch) genommen werden. Der Artikel entscheidet hierüber. Der Infinitiv verliert mit der Bestimmung auch unmittelbar seine Infinitivnatur und ist substantiv, so wie er bestimmt ist. An sich ist er nicht, wie das Nomen, zugleich der Bestimmtheit und Unbestimmtheit fähig.
Es hat aber auch aus einem anderen Grunde eine andere Bewandniß mit dem Artikel
beim Infinitiv, als beim Nomen.
Euer Wohlgeboren nennen den Artickel |sic| ein ideales pronomen demonstrativum, Bernhardi, der ungebührlich kurz über ihn ist, (§ 62 N° 4) ein determinatives.
Ich gestehe, daß ich mit beidem nicht ganz übereinstimmen kann. Meiner Meinung
nach, ist der Artikel gar kein pronomen, sondern gehört
in die Kategorie der Zahlwörter. Die Substantiva können
sich nemlich auf
ein
<|![]() Humboldt| Ein>
Individuum, auf durch Zahl bestimmte, auf unbestimmt gelassene, |66v| endlich auf alle Individuen der Gattung, oder was dasselbe ist,
auf den allgemein gefaßten Begriff der Gattung beziehen, und der Artickel ist
der Redetheil, welcher diesen verschiedenartigen Umfang bestimmt. Wenn daher
Euer Wohlgeboren § 7 No 1 sagen: der Artickel zeigt an,
daß der von uns ausgesprochene Begriff von uns auf ein Individuum bezogen, und
in der Vorstellung als ein bestimmtes gedacht werde, so pflichte ich hiervon dem
letztern vollkommen bei, aber das Erste erschöpft meines Erachtens, den Begriff
nicht. Zwar werden Euer Wohlgeboren wohl meinen, daß der allgemeine Begriff, der
Mensch, das Thier, ein ideales Individuum sei, und dann
allerdings kommt es auf dasselbe hinaus. Doch weiß ich nicht, ob man bei dieser
Vorstellungsart an Deutlichkeit gewinnt. Als Pronomen
kann ich den Artickel nicht anerkennen, weil das Pronomen ein repräsentativer Redetheil ist,
und der Artickel das Nomen nicht repräsentirt, sondern begleitet. Dies thun zwar die pronomina demonstrativa auch (dieser Mensch) allein sie können doch
allein stehen, der Artickel nicht, und wenn sie das Substantiv bei sich führen, sind sie im Grunde |67r| auch nur
in Adjectiva verwandelte Adverbia
loci, nicht mehr wahre Pronomina. Im Deutschen
unterscheiden wir auch sehr deutlich durch die Aussprache der<,> wenn es Pronomen
demonstrativum und wenn es Artickel ist, obgleich im Plural diese Unterscheidung freilich hinwegfällt. Es kommt indeß
hierauf nichts an. Will man auch den Artickel als Pronomen ansehen, so bleibt immer gewiß, daß jenen Umfang der
Bedeutung der Substantiva zu bezeichnen sein Amt ist.
Wendet man nun das auf den Infinitiv an, so könnte er
sich zwar auch auf Eine Handlung, mehrere Handlungen unbestimmt, und die Gattung
der Handlungen überhaupt, erstrecken. So wie er aber das thut, betrachtet er die
Handlungen, als Substanzen, ist die Darstellung derselben, und wird Substantiv. Auf diese Weise <|
Humboldt| Ein>
Individuum, auf durch Zahl bestimmte, auf unbestimmt gelassene, |66v| endlich auf alle Individuen der Gattung, oder was dasselbe ist,
auf den allgemein gefaßten Begriff der Gattung beziehen, und der Artickel ist
der Redetheil, welcher diesen verschiedenartigen Umfang bestimmt. Wenn daher
Euer Wohlgeboren § 7 No 1 sagen: der Artickel zeigt an,
daß der von uns ausgesprochene Begriff von uns auf ein Individuum bezogen, und
in der Vorstellung als ein bestimmtes gedacht werde, so pflichte ich hiervon dem
letztern vollkommen bei, aber das Erste erschöpft meines Erachtens, den Begriff
nicht. Zwar werden Euer Wohlgeboren wohl meinen, daß der allgemeine Begriff, der
Mensch, das Thier, ein ideales Individuum sei, und dann
allerdings kommt es auf dasselbe hinaus. Doch weiß ich nicht, ob man bei dieser
Vorstellungsart an Deutlichkeit gewinnt. Als Pronomen
kann ich den Artickel nicht anerkennen, weil das Pronomen ein repräsentativer Redetheil ist,
und der Artickel das Nomen nicht repräsentirt, sondern begleitet. Dies thun zwar die pronomina demonstrativa auch (dieser Mensch) allein sie können doch
allein stehen, der Artickel nicht, und wenn sie das Substantiv bei sich führen, sind sie im Grunde |67r| auch nur
in Adjectiva verwandelte Adverbia
loci, nicht mehr wahre Pronomina. Im Deutschen
unterscheiden wir auch sehr deutlich durch die Aussprache der<,> wenn es Pronomen
demonstrativum und wenn es Artickel ist, obgleich im Plural diese Unterscheidung freilich hinwegfällt. Es kommt indeß
hierauf nichts an. Will man auch den Artickel als Pronomen ansehen, so bleibt immer gewiß, daß jenen Umfang der
Bedeutung der Substantiva zu bezeichnen sein Amt ist.
Wendet man nun das auf den Infinitiv an, so könnte er
sich zwar auch auf Eine Handlung, mehrere Handlungen unbestimmt, und die Gattung
der Handlungen überhaupt, erstrecken. So wie er aber das thut, betrachtet er die
Handlungen, als Substanzen, ist die Darstellung derselben, und wird Substantiv. Auf diese Weise <|![]() Humboldt| sagt> man im Deutschen: ein, mehrere, das Essen, auch ein Gehen,
einiges Gehen und das Gehen. Beim Verbum finitum kann
die Frage des Umfangs nicht vorkommen, da es immer einen individuellen Fall
ausspricht, und da der Infinitiv meiner Vorstellung
nach, die ganze Verbal natur beibehält, so kann in den
Worten: ich sehe blitzen, niemand veranlaßt sein, nach dem Umfang dieses
Ausdrucks zu fragen. Jeder fühlt, daß sie heißen |67v| sollen, daß es
blitzte und ich es sah, und es ist also hier weder an einen bestimmten noch
unbestimmten Artickel zu denken. Wie ein Artickel hinzukommt, ist der Infinitiv nicht mehr Infinitiv.
Daß, wie Euer Wohlgeboren S 15 sagen, jeder mit Substantiven zusammengestellte Infinitiv den Artickel haben müßte, sehe ich nicht ein. Es dient
vielmehr, wie in der von Ihnen angeführten Stelle Anacreons, zur Abwechslung, wenn auch auf
wieder
<|
Humboldt| sagt> man im Deutschen: ein, mehrere, das Essen, auch ein Gehen,
einiges Gehen und das Gehen. Beim Verbum finitum kann
die Frage des Umfangs nicht vorkommen, da es immer einen individuellen Fall
ausspricht, und da der Infinitiv meiner Vorstellung
nach, die ganze Verbal natur beibehält, so kann in den
Worten: ich sehe blitzen, niemand veranlaßt sein, nach dem Umfang dieses
Ausdrucks zu fragen. Jeder fühlt, daß sie heißen |67v| sollen, daß es
blitzte und ich es sah, und es ist also hier weder an einen bestimmten noch
unbestimmten Artickel zu denken. Wie ein Artickel hinzukommt, ist der Infinitiv nicht mehr Infinitiv.
Daß, wie Euer Wohlgeboren S 15 sagen, jeder mit Substantiven zusammengestellte Infinitiv den Artickel haben müßte, sehe ich nicht ein. Es dient
vielmehr, wie in der von Ihnen angeführten Stelle Anacreons, zur Abwechslung, wenn auch auf
wieder
<|![]() Humboldt| einander>
bezogene Begriffe, die einen als Dinge, Substanzen, die andern als
bloße Energien, Bewegungen dargestellt werden.
Humboldt| einander>
bezogene Begriffe, die einen als Dinge, Substanzen, die andern als
bloße Energien, Bewegungen dargestellt werden.
So gestehe ich, kann ich mich von meiner Ansicht, den Infinitiv strenge zum verbum zu nehmen, und ihn als etwas vom Attributivum und Substantivum Verschiedenes anzusehen, nicht trennen, und wenn ich die von Euer Wohlgeboren aufgestellten Verbal Substantiva betrachte, so weichen sie auch fast in allen Dingen von andern Substantiven ab.
Ich würde indeß Euer Wohlgeboren Geduld zu ermüden fürchten, wenn ich hierin weiter einginge; ich will mich daher darauf beschränken, nur noch des § 16 über die tempora des Infinitivs zu erwähnen.
Zuerst möchte ich bemerken, daß Bern-|68r|hardi gar nicht die Theorie der relativen Zeiten annimmt, die auch mir aus Gründen, die es hier zu weitläuftig sein würde, zu entwickeln, nicht die richtige scheint. Bernhardi leitet die neun, nicht Aoristischen tempora, nach der bessern Alten, Harris, Reiz und Wolfs Vorgang aus der Beziehung der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (nicht wieder, wie bei der Theorie der relativen Zeiten geschieht, auf eine andere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) sondern auf den Anfangs- Mittel- und Endpunkt der einen Zeitraum durchlaufenden Energie oder Handlung her.
Diese drei Punkte nun gehören dem Participium an, die drei Zeiten aber der Copula, dem Verbum Seyn, und daraus folgt nun schon unmittelbar, daß der Infinitivus, der bloß aus dem Participium entsteht, auch, außer der Aoristen, nur drei Tempora haben kann.
Euer Wohlgeboren haben sich nun freilich nicht genau darüber erklärt, ob Sie die
tempora, wie es scheint, bloß
aus
<|![]() Humboldt| in>
dem Zeitbegriff, der im momentanen Merkmal enthalten ist, oder zugleich
in der Copula finden. Da aber die Copula doch auch eine Zeit ausdrücken muß, so würden doch auch in
Ihrem momentanen |68v| Merkmal nur drei Zeitpunkte, außer der Aoristen liegen, und den Infinitiv nicht mehr haben können.
Humboldt| in>
dem Zeitbegriff, der im momentanen Merkmal enthalten ist, oder zugleich
in der Copula finden. Da aber die Copula doch auch eine Zeit ausdrücken muß, so würden doch auch in
Ihrem momentanen |68v| Merkmal nur drei Zeitpunkte, außer der Aoristen liegen, und den Infinitiv nicht mehr haben können.
Es scheint mir dies aber auch aus einem andern Grunde zu folgen. Der Infinitiv ist immer von einem andern verbum abhängig. Selbst wenn ihn ein Nomen regiert, ist dies doch mit einem verbum in einem Satze verknüpft. Dies verbum muß ein verbum finitum sein, und also in irgend einer Zeit seine Aussage machen. Nehme ich nun relative Zeiten an, so habe ich hier die eine Reihe der drei möglichen Zeiten, und es kann daher im Infinitiv nur noch eine zweite liegen. Hätte der Infinitiv für sich zwei Reihen, als soviel 6 tempora erfordern würden, so kämen 3 Reihen in Contact, was wohl denkbar wäre, allein zu keinem neuen Resultat führen könnte.
Denn ich gestehe, daß ich auch in den von Euer Wohlgeboren angeführten Beispielen
den Unterschied nicht finden kann. ὁ παῖς. θρηνήσεται
τετύφθαι und τετύψεσθαι scheinen
mir ganz dasselbe anzudeuten. Daß der Knabe noch nicht geschlagen worden ist,
indem die Worte gesprochen werden, liegt in dem futurum
θρηνήσεται. Hätte er die Schläge schon |69r| bekommen, könnte sein Weinen nicht erst künftig sein. Die erste
Redensart heißt: er wird weinen, daß er geschlagen worden ist, die andre, wenn
ich τετύψεσθαι als futurum
exactum übersetze, daß er wird geschlagen worden sein. Wenn einzuschieben, scheint mir die Redenart nicht zu
erlauben. Die Worte sind hier freilich anders, aber die Sache ist dieselbe, das
zweite futurum das im Infinitiv
liegt, kann, da schon eines vorhanden ist, nichts hinzufügen. Das Weinen ist
zukünftig, die Schläge, als dessen Ursach, werden als vergangen vorgestellt, an
sich sind sie auch, wie das Weinen, noch zukünftig, und es ist gleich, ob man
diese Zukunft mit ausdrückt oder nicht. Anders gestehe ich die Sache nicht
einsehen zu können. <|![]() Humboldt| In Xenophons Anabasis (I, 5, 16.)
εἰ γάρ τινα ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίζετε, ἐν
τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ τε κατακεκόψεσθαι κ τ. λ.[e] scheint mir dieser letzte Infinitivus keinen andern Sinn zu geben, als der Infinitivus des nicht reduplicirten Futurum thun würde. Man könnte zwar eine rhetorische
Verstärkung darin finden, daß Cyrus nicht sagt, daß, so wie sie kämpfen werden,
auch er werde niedergemacht werden, sondern daß er dadurch eo ipso schon werde niedergemacht worden seyn.
Alleine diese Nüance der Bedeutung ist hier aufs mindeste nicht nothwendig,
und ich finde sie nicht einmal passend, weil der Gebrauch des futurum exactum, wenn er auch die Behauptung des
Niedermachens verstärkt, den Zusammenhang dieser Niederlage mit dem zu
verhütenden Kampfe weniger sichtbar macht, da, indem die Niederlage als
schon geschehen dargestellt ist, sie ja auch einen andren Grund, als den
Kampf gehabt haben könnte. <(Ein andres Beispiel s. Herodot. I. 80. Ed.
Schweigh. I. 97. l. 3.>> Das zweite
Beispiel
<|
Humboldt| In Xenophons Anabasis (I, 5, 16.)
εἰ γάρ τινα ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίζετε, ἐν
τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ τε κατακεκόψεσθαι κ τ. λ.[e] scheint mir dieser letzte Infinitivus keinen andern Sinn zu geben, als der Infinitivus des nicht reduplicirten Futurum thun würde. Man könnte zwar eine rhetorische
Verstärkung darin finden, daß Cyrus nicht sagt, daß, so wie sie kämpfen werden,
auch er werde niedergemacht werden, sondern daß er dadurch eo ipso schon werde niedergemacht worden seyn.
Alleine diese Nüance der Bedeutung ist hier aufs mindeste nicht nothwendig,
und ich finde sie nicht einmal passend, weil der Gebrauch des futurum exactum, wenn er auch die Behauptung des
Niedermachens verstärkt, den Zusammenhang dieser Niederlage mit dem zu
verhütenden Kampfe weniger sichtbar macht, da, indem die Niederlage als
schon geschehen dargestellt ist, sie ja auch einen andren Grund, als den
Kampf gehabt haben könnte. <(Ein andres Beispiel s. Herodot. I. 80. Ed.
Schweigh. I. 97. l. 3.>> Das zweite
Beispiel
<|![]() Humboldt| von Ew. angeführte Beispiel>
ist mir noch weniger klar. Welch ein Infinitiv
auch schlagen sein möchte, kann ich in den Worten
immer nicht mehr sehen, als daß die <|
Humboldt| von Ew. angeführte Beispiel>
ist mir noch weniger klar. Welch ein Infinitiv
auch schlagen sein möchte, kann ich in den Worten
immer nicht mehr sehen, als daß die <|![]() Humboldt|
Velleitaet>[f] des
Schlagens hier in die vergangene Zeit der währenden Handlung gesetzt ist, und
ich finde nicht, daß, wenn der Infinitiv nun auch eine
vergangene Zeit einer währenden Handlung anzeigte, daraus der Sinn hervorgienge,
daß das Schlagen mit dem Wollen vorüber sei. Denn die Phrase: sie hatten
beschlossen, daß sie mich schlügen, wo beide verba im
Imperfectum stehen, scheint mir kein größeres Licht
|69v| über die Sache zu geben, als die mit dem Infinitiv.
Humboldt|
Velleitaet>[f] des
Schlagens hier in die vergangene Zeit der währenden Handlung gesetzt ist, und
ich finde nicht, daß, wenn der Infinitiv nun auch eine
vergangene Zeit einer währenden Handlung anzeigte, daraus der Sinn hervorgienge,
daß das Schlagen mit dem Wollen vorüber sei. Denn die Phrase: sie hatten
beschlossen, daß sie mich schlügen, wo beide verba im
Imperfectum stehen, scheint mir kein größeres Licht
|69v| über die Sache zu geben, als die mit dem Infinitiv.
Das sogenannte paulo post futurum der Griechen scheint mir kein gültiger Einwurf gegen eine Behauptung, die, meiner Ueberzeugung nach, so streng und evident aus den allgemeinen Begriffen folgt. Wie den Sprachen Formen fehlen, so können sie davon auch mehr haben, als nöthig ist. Dies ist um so mehr möglich, als wir die Geschichte keiner Sprache genau genug kennen, um zu wissen, ob nicht ursprünglich gewisse Formen ganz anders gebraucht worden sind. Ich erinnere mich nicht, ob man wohl die Stellen gesammelt hat, in welchen der Infinitiv dieses tempus vorkommt, und deren wohl nicht viele sein werden. Dies müßte auf jeden Fall belehrend sein.[g]
Fußnoten
- a |Editor| Beigefügt ist dem Briefentwurf die Nummer 213 der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung vom November 1826, in der sich eine Rezension der Schrift Schmidts befindet, Sp. 257–263. [FZ]
- b |Editor| Der Schreiber hatte an dieser Stelle eine Lücke gelassen.
- c |Editor| Der nächste Satz folgt nach einem größeren Abstand.
- d |Editor| Humboldt hat hier eine vom Schreiber gelassene Lücke durch einen Strich geschlossen.
- e |Editor| Laut Bücherverzeichnis (AST, Archivmappe 75, M. 4, Bl. 148v) besaß Humboldt die Zeune-Ausgabe von 1785: "Xenophontis anabasis. Ed. Zeune. Leipz. Fritsch. 1785. 8." [FZ]
- f |Editor| Das Wort wurde durch Humboldt in eine vom Schreiber frei gelassene Lücke eingesetzt.
- g |Editor| Im Druck von 1853 wird der im Konzept nicht vorhandene Schluss des Briefes wiedergegeben: „[Eigenhändige nachschrift des Verfassers.] Ew. wohlgeboren werden entschuldigen, daß ich nicht mit eigner hand geschrieben habe. Die fremde ist leserlicher und ich wünschte mein concept zu behalten. Ich bitte Sie zu glauben, daß ich es zu schätzen weiß, in Ihnen einen mann gefunden zu haben, der diese grammatischen gegenstände, die jetzt leicht mit dem namen philosophischer spitzfindigkeiten gebrandmarkt werden, gern einer neuen untersuchung unterwirft. Mein halten an Bernhardi müssen Sie mir verzeihen: ich bleibe gern bei dem bisherigen. bis es sich als nicht mehr zu vertheidigen erweist. Indem ich den forschungen ew. wohlgeboren zu ihrer genugtuung und zum allgemeinen nutzen der wissenschaft ungestörten und glücklichen fortgang wünsche, wiederhole ich Ihnen die versicherung meiner ausgezeichneten hochachtung. Tegel, den 28. October 1826. W.v.Humboldt“