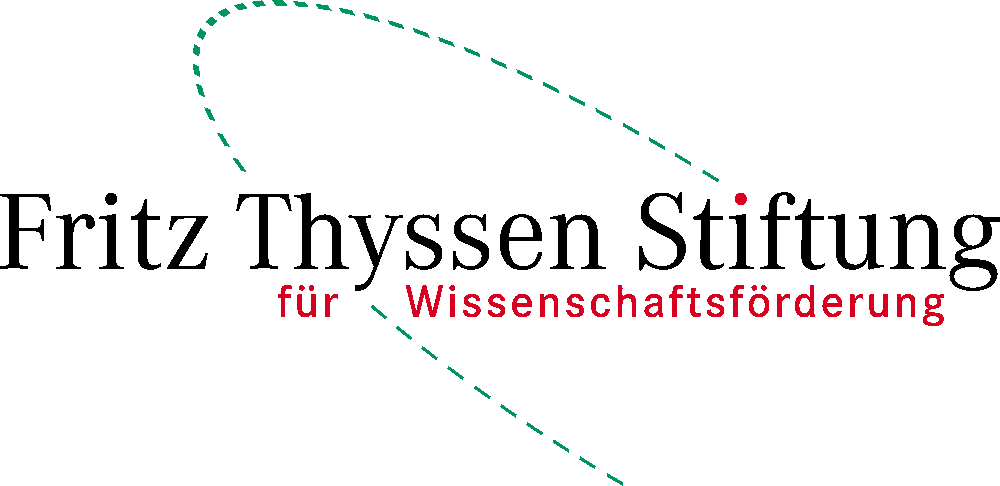Friedrich Heinrich Jacobi an Wilhelm von Humboldt, 02.09.1794
Pempelfort, den 2ten Sept. 1794.Wo soll ich anfangen, lieber theuerster Freund, Ihnen zu danken, mich zu entschuldigen, Rede und Antwort zu geben, so daß es Ihnen und mir selbst einigermaßen Genüge thue? Ihren Brief vom 26sten April, mit den köstlichen Beilagen, erhielt ich zu Münster, wo ich seit dem Jahre 1789 nicht gewesen war, ungeachtet wiederholter Besuche, die ich unterdessen von Fürstenberg und der Fürstin von Gallitzin erhalten hatte. Ihnen von dort aus zu antworten, war unmöglich. Gleich nach meiner Zurückkunft fingen die Kriegsunruhen von der niederländischen Seite her an. Ich war in diese Dinge auf eine mannigfaltigere Weise verwickelt, als ich Ihnen hier eröffnen kann. Den 15ten Junii reiste ich nach Aachen, und von diesem Tage an bin ich nicht zu Athem gekommen. Meine ohnedieß schlechte Gesundheit hat von der beständigen Anstrengung sowohl des Gemüths als des Kopfs, worin ich diese Zeit über gelebt habe, sehr gelitten. Um mich etwas zu erholen, reiste ich Freitag Nachmittag zu Dohm nach Cöln. Gestern Abends kam ich vergnügt zurück, und siehe da, ihr liebes Paket lag auf meinem Tische. Unmöglich kann ich Ihnen meine Freude beschreiben. Ich hatte das so sehr gewünscht, daß Sie mein Recensent in der Allg. Litt. Zeitung werden möchten, und aus Ihrem Briefe vom 26sten April einige Hoffnung dazu geschöpft. Lebhaft genug war dennoch die Ueberraschung. Aber warum zuvor die Handschrift? Es ängstigte mich, daß ich diese vor dem Druck lesen sollte, und ich war zugleich ungeduldig, sie nicht schon gedruckt vor mir zu sehen. Daß mir diese Ungeduld durch das Lesen nicht vergangen ist, sehen Sie aus der Eile, womit ich Ihnen Ihre Handschrift zurückschicke. Ich fürchte nur, man wird zu sehr in meinem Richter den Freund erkennen. Aber auch Ihre Partheilichkeit wird mir Ehre bringen.
Was Sie über den Stein des Anstoßes sagen, an dem alle Leser, minder oder mehr, so oder anders, ein Aergerniß nehmen, war mir über alle Maßen willkommen. Wer je in seinem Leben geliebt hat, weiß, daß die erste Bedingung der Liebe Feindseligkeit gegen die thierischen Triebe ist, und ich kann dieß einmal nicht für die Täuschung eines bösen Geistes halten, der uns nur zum Besten haben will. Ich kann es also zugeben, daß man annehme, Woldemar’s Freundschaft zu Henriette sey von Anfang an leidenschaftlicher Natur gewesen, und seine Abneigung, sich mit ihr zu verheirathen, bleibt dennoch in der Natur und deutet auf einen so schönen Grund derselben, daß es verzeihlich ist, sich hier etwas zu versteigen. Diese Materie ist so zart, daß sie sich schwer, zumal im Gange der Erzählung, ins Licht stellen ließ; doch hätte ich mehr dazu thun können und sollen, als geschehen ist.
* * *
Einen ganz ausnehmenden Gefallen haben Sie mir damit gethan, daß Sie auf die doppelte Ursache der Zerrüttung Woldemar’s aufmerksam machen. Es ist mir unbegreiflich, wie fast alle Leser bei dem ersten Anlasse, dem Gelübde, hängen bleiben können, der doch ohne weitere Folgen geblieben wäre, wenn nicht der zweite, viel wichtigere, hinzu kam. Daß aber beide Ursachen zusammengenommen ohne weitere Zuthat hinreichend sind, einen Menschen Woldemarischer Art in den Zustand zu versetzen, worin ich meinen armen Sünder gerathen lasse, dafür stehe ich als Psycholog mit meinem Namen. Dieß verhindert mich aber nicht, Ihnen darin, was Sie über das Befremdende sowohl in den Charakteren als der Geschichte meiner Personen bemerken, vollkommen Recht zu geben. Ich habe diese Bemerkung selbst in einer Vorrede zu Woldemar, die nicht zu Stande gekommen ist, weil mich Dohm an ihrer Ausarbeitung fast mit Gewalt verhinderte, machen wollen. Boileau’s bekannt Warnung: le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable![a] scheint durchaus in diesem Werk außer Acht gelassen. Hierüber gedachte ich mich auch eben so zu entschuldigen, wie Sie mich entschuldigt haben, nämlich dadurch, daß im Woldemar der Dichter mehr im Dienste des Philosophen, als der Philosoph im Dienste des Dichters ist, und es erlaubt seyn muß, in diesem Falle das Wahrscheinliche dem Wahren nachzusetzen. Daneben wollte ich bemerken, daß auch der Dichter und jeder Künstler das Wahrscheinliche hintansetzen muß, und nur unter dieser Bedingung diejenige Täuschung, die sein Zweck ist, zuwegebringen kann. Ja das Werk der Kunst setzt gleichsam eine vorhergegangene Verabredung mit dem, auf den es wirken soll, voraus, und das größte Genie macht oft die härtesten Bedingungen. –
In der gedachten nicht zu Stande gekommenen Vorrede sollte auch der Spruch des Fenelon am Ende, aus dem Fenelon erläutert und gerechtfertigt werden. Sie finden wohl in der dortigen Bibliothek oder bey einem Freunde die Oeuvres |sic| spirituelles du Fénélon. Lesen Sie, mir zu Lieb’ und mir zu Ehren, im ersten Theile den kleinen Aufsatz sur le pur amour[b], und sagen Sie mir nachher, ob dieser Mystiker viel von Kant zu lernen hatte.
Noch ein Wort zur Rechtfertigung meiner Henriette. Sie warfen Woldemar mit Grund vor, daß er ein Selbstpeiniger sey. Diesen Vorwurf verdient er in so hohem Grade, daß ich gefürchtet habe, Henriette möchte von dem Widerwillen neiden, den er erregt; man möchte die Geduld und Langmuth, die sie gegen ihn beweist, ihr nicht zu Gute halten können. Daß aber derselbe Vorwurf der Selbstpeinigung auch Henrietten gemacht werden könne, leugne ich schlechterdings. Ich leugne auch, daß sie durch Woldemar umgebildet worden; ihr eigener, nicht zu verwandelnder Charakter hat sich nur an Woldemar entwickelt. Auch halte ich diese Henriette, obgleich die idealisirteste Person im Roman, für die am mehrsten individualisirte, und habe hierüber das Zeugniß fast aller Leser, die sich gegen mich geäußert haben, für mich; mehrere sagten mir, es wäre ihnen beim Lesen so geworden, als müßte diese Henriette irgendwo vorhanden seyn, ob man sich gleich wieder sagen müsse, solch ein weibliches Wesen könne nicht vorhanden seyn.
Daß sie |sic| meine Allwine hervorstellten mit dem Sinn, mit dem Gefühl – dafür muß ich Sie noch besonders und eigenst an mein Herz drücken. Den mehrsten Lesern erscheint sie als eine uninteressante Nebenperson, die kaum so viel Eindruck macht, daß sie einen dauert. Doch giebt es Ausnahmen. So schrieb mir Stolberg: "für die Darstellung der holdesten Weiblichkeit im Charakter der Allwina hast Du den wärmsten Dank der spätesten Enkelinnen verdient." Ich muß aufhören, Ihnen zu danken, denn ich käme an kein Ende. Da sie |sic| sich meines Enfant trouvé mit so viel herzlichem Interesse angenommen haben, so thue ich Ihnen vielleicht einen Gefallen, wenn ich Ihnen sage, welche Stellen im Buche, wenigstens im zweiten Theile, mir die liebsten sind. Sie finden diese S. 94. – 105. – 123 – 25. – 138. – 141 und 142. – 173 – 75. Worauf ich mir am meisten einbilde, ist der Auftritt S. 246 – 273, vornehmlich Woldemar’s Beichte. Das größte Verdienst aber schreibe ich mir zu wegen der Darstellung der aristotelischen Moral-Philosophie. Diese wenigen Blätter haben mich mehr Arbeit, Anstrengung und Nachdenken gekostet, als irgend etwas, was ich im philosophischen Fache geliefert habe. Es hat mich darum nicht wenig verdrossen, daß unser Freund Heyne diesen so mühsam ausgearbeiteten Auszug eingerückte Stellen aus dem Aristoteles nennt.
Fichte’s Programm ist mir gleich bei seiner Erscheinung von Göthe zugeschickt worden. Ich habe geantwortet wie folgt: "Fichte’s Schrift habe ich gleich vorgenommen und mit Aufmerksamkeit, obgleich unter tausend Störungen gelesen. Sie hat mir Freude gemacht. Fichte scheint mehr als alle seine Vorgänger, in der Predigt des in die Welt gekommenen neuen Lichts, auch noch für das am ersten Tage geschaffene Licht ein Auge – ich meine wenigstens Ein Auge – offen gehalten zu haben. – Wir müssen nun abwarten, was er weiter zu Tage bringen wird aus dem noch uneröffneten Schachte seiner drei Absoluten." Wirklich war meine Freude an Fichte’s Programm so groß und so viel lebhafter, als ich mich gegen Göthe ausließ, daß ich mehrere Tage mit dem Gedanken umging, an Fichte zu schreiben und ihm zu sagen, wie lieb mir seine Erscheinung wäre. – –
Fußnoten
- a |Editor| Boileau, Nicolas (1674): L’Art poétique, Paris: Thierry, chant III, vers 48. [FZ]
- b |Editor| In der Ausgabe von 1740 auf den S. 50–83. [FZ]