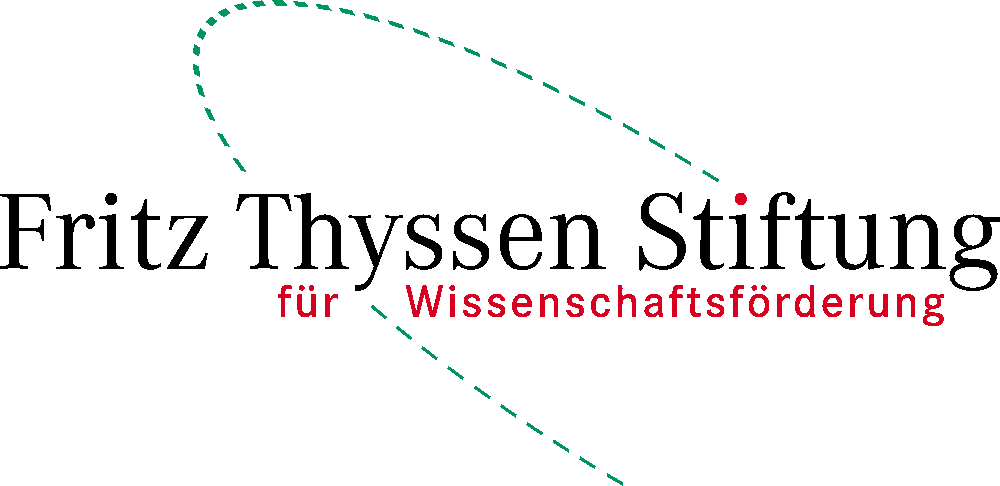Wilhelm von Humboldt an Friedrich Heinrich Jacobi, 15.10.1796
Berlin, 15. 8br. 1796.Ihr Brief, lieber theurer Freund, hat mir eine unaussprechliche Freude gemacht. Stinchen hatte meiner Frau wenige Tage vorher die Niederkunft der Poel gemeldet,[a] und in diesem Briefe schrieb sie uns zugleich, dass Ihnen die kalte Witterung so übel bekäme. Ganz so schlimm, sehe ich aus dem Ihrigen, ist es nun glücklicherweise nicht, aber immer fürchte ich doch, dass das Hamburger Klima, der dicken Mauern Françoisens ungeachtet, Ihrer schwächlichen Gesundheit nachtheilig seyn möchte. Warum muss der fatale Krieg Sie so lange aus Ihrem friedlichen Pempelfort u. von dem Genuss eines milderen Himmels vertreiben?
Ihr Dank für unsern Besuch hat uns innigst gerührt. Welche schönere Freude hätten wir uns bereiten können, als uns die Tage gegeben haben, die wir so froh mit einander durchlebten. Sie glauben nicht, theurer Jacobi, wie unendlich oft wir beide von diesen Abenden, diesen Unterredungen sprechen. Der ganze volle Eindruck, den Ihre Bekanntschaft, Ihre liebevolle Freundschaft früher auf mich gemacht hatte, ist, wie tief u. lebendig er auch war, gleichsam neu in mir geworden; u. meiner Frau ist Ihr Wesen eine der grossen u. süssen Erscheinungen gewesen, welche die Seele u. das Herz für das ganze Leben bereichern. Lassen Sie uns nur im Frühjahr gewiss die Freude des Wiedersehens geniessen.
Für unsre schriftliche Unterhaltung bis dahin ist mir die Länge u. Ausführlichkeit Ihres Briefs ein günstiges Omen gewesen. Ueber die Recension des Vossischen Homers bin ich schlechterdings darin mit Ihnen einig, dass Sie sehr viel Wahres, u. nicht wenig treffende u. feine Bemerkungen enthält. Ueber einzelne Stellen bin ich ein schlechter Richter. Ich habe die Sprache nie ex professo studirt, das Wenige, was ich davon weiss, habe ich nur durch den Gebrauch erlernt, u. wenn ich entscheiden soll, ob diese oder jene Wortfügung richtig u. deutsch ist oder nicht? so sehe ich mich oft vergebens nach Principien um. Construktionen, die gegen eine gesunde Logik verstossen, wird jeder leicht unterscheiden; ebenso solche, die offenbar einer fremden Sprache, vorzüglich einer neueren, zugehören. Wie ist es nun aber mit den feineren Fällen? Hier sind zwei Klippen zu vermeiden: 1. zu streng am blossen Hergebrachten zu kleben. 2. gegen den Genius der Sprache Neuerungen zu wagen. Die Regel darin ist im Allgemeinen leicht zu bestimmen: man muss die Sprache erweitern, aber ihrem Geist u. ihrem Charakter gemäss. Hier ist nun eben die Hauptschwierigkeit die, den Charakter einer Sprache so genau u. individuell zu bestimmen, dass diese Bestimmung in einzelnen Fällen fruchtbar werden kann. Diess hat mir nie gelingen wollen, u. hierin verlässt auch der Rec. seine Leser gänzlich. Wenn man bedenkt, wie leicht schon ein Mensch seine moralische Eigenthümlichkeit entweder unterdrückt oder übertreibt, wieviel leichter muss diess bei Behandlung einer Sprache geschehen? Nehmen Sie nur den einzigen Fall der Stellung der Beiwörter. Homer setzt fast immer mehrere dem Hauptbegriff nach.
Singe mir, Muse, den Zorn u. s. w.
Den verderblichen u. s. f.
Diese Stellung ist seinem Zeitalter angemessen. Das Objekt wird erst bloss vor das Auge gestellt, nun wird es noch aufmerksamer betrachtet u. die Eigenschaften fallen dem Sänger nach u. nach ein. Diese ganze Stellung ist offenbar dem sinnlichen kindischen Verstand, der natürlichen Phantasie die gemässeste. Unsre Sprache hingegen ist für den raisonnirenden Verstand. Sie giebt uns ganze u. verwickelte Phrasen, setzt oft die Hauptsache zuletzt, will (worin dünkt mich der Charakter aller modernen Sprachen gegen die älteren liegt) nicht, dass die einzelnen Theile der Rede für sich, sondern immer die ganze Rede zusammen genommen werden soll. Ist es nun ihrem Charakter zuwider, sie zu homerisiren? oder wenn man diess nicht soll, wie ist Homer übersetzbar? Ohne diese Frage entscheiden zu wollen, ist es, dünkt mich, offenbar, dass Voss die grossen Vorzüge unsrer modernen Sprachen verkennt, u. ihrer Eigenthümlichkeit Gewalt anthut. Aber ihm zu zeigen: hier oder dort bist du zu weit gegangen, wird immer sehr schwer seyn. Auch Ihr Beispiel beweist mir diess abermals. Was der Rec. tadelt scheint Ihnen erträglich, mir manches von diesem gänzlich unrichtig, dagegen andres, das Sie verwerfen, gar leicht zu erdulden. Gewiss liegt also die Sache nur am Totaleindruck. Nur weil so viele, unglaublich viele Wortfügungen gebraucht sind, die nur so eben noch hingehn, oder über deren Gültigkeit wir zweiflen, wird das Ganze schwer u. unverständlich. Ueber den Periodenbau, den älteren u. modernen u. den idealischen, liesse sich sehr viel neues u. feines sagen. Der Homerische ist noch eigentlich keiner, es sind einzelne unverbundne Bilder u. Gedanken. Der ihm entgegengesetzte barbarische ist ein unbehülfliches Hinstolpern zum Schlusswort, eine Masse, die sich nirgends selbst hält, u. hinfiele, wenn man den Schluss dem Leser nur einen Augenblick vorenthielte. Der schöne ist ein gegliederter, gelenkiger organischer Körper, in dem jeder einzelne Theil schon ein kleines Ganzes ist, der aber seine vollendete Schönheit nur dadurch erhält, dass man ihn als eine Einheit betrachtet. Daher ich in diesem die Vossische Sorgfalt die Worte gerade nach der Folge der Begriffsverhältnisse hinzugeben nicht billigen kann. Dafür haben wir ja den Verstand, dass wir ihn zum Verstehen anwenden; und dafür ist mir Sprache ja ein Symbol, dass wir ihr nicht alle conventionelle Form rauben sollen.
Mit zwei Punkten der Recension bin ich höchst unzufrieden, einmal mit dem Ton, der in einigen Stellen sehr muthwillig ist. Ein solcher Sansculottismus ist mir in den Tod zuwider, u. dann mit der allgemeinen Ansicht des Homers, der nun kaum noch als ein Künstler gelten, in dem alle metrische Schönheiten z. B. zufällig seyn sollen.
Ich bin über diese Rec. so weitläuftig geworden, dass ich nicht Zeit haben werde, Ihnen noch viel über Schiller u. den Don Carlos zu sagen, obgleich mich doch dieser Gegenstand noch bei weitem mehr interessirt. Also heute nur Einiges Wenige u. nur vorläufig, wenn Sie bei Ihrem Vorsatz, Schillern zu lesen beharren, u. mit mir manchmal darüber reden wollen.
Ich habe Schillern, nicht gerade seine Werke, obgleich ich auch in diesen doch ziemlich bewandert bin, äusserst genau studirt, und ich mache es mir zum eigentlichen Geschäft, diess Studium zu einer gewissen Vollendung zu bringen. Ich fahre darin um so unermüdeter fort, weil ich überzeugt bin, dass das Studium eines so seltnen, u. in seiner Art so einzigen Genies einen erweiterten Begriff des menschlichen Geists überhaupt giebt. Ich habe nie einen gesehen, dessen Geist mir so merkwürdig gewesen wäre, u. so aufrichtig ich z. B. Göthen u. Kant verehre, so ist mir keiner von beiden für die Kenntniss der menschlichen Intellektualität so wunderbar u. wichtig. Sie fühlen schon, dass ich hiermit nicht eine Vergleichung absoluter Grösse machen, dass ich vielmehr einzig Schillern eine eigne Klasse anweisen will, die er auch, meines Erachtens, schlechterdings bildet. Kant ist ein entschiednes philosophisches, Göthe ein entschiednes Dichtergenie, beide vielleicht u. wie ich ernsthaft glaube, in höherem Grade, als bisher je eins aufstand, aber ihre Gattung ist bekannt u. zu allen Zeiten da gewesen. Mit Schiller ist es ein durchaus anderer Fall. Er trägt durchaus u. in allem, was er treibt, das Gepräge des ächten Genies, von dem es nicht möglich ist sich zu irren, aber sowohl gegen seinen dichterischen, als gegen seinen philosophischen Beruf kann ich starke Ausnahmen machen. Diess allein nun würde gar nicht viel beweisen. Es giebt genug halbe u. auch hie u. da wirkliche Genies, die aus Mangel an bestimmter Ausbildung, oder an entschiedenem Triebe zwischen zwei Fächern herumschwanken, u. darum in beiden unglücklich u. für sich nur um so unvollkommner sind. Diess aber ist gewiss am wenigsten nach Ihrem Urtheil mit Schiller der Fall. In ihm strebt der Geist eigentlich das philosophische u. poetische Genie in einander zu verschmelzen, u. dadurch ist er Schöpfer einer Poesie, von der noch bis jetzt kein Beispiel vorhanden war, u. die man sehr unrichtig mit der bisherigen sogenannten philosophischen verwechslen würde, so wie er eben dadurch auch in der Philosophie eine Originalität erlangt hat, die sich auf weit mehr, als auf den blossen Vortrag erstreckt. Beide sind freilich bis jetzt noch nicht eigentlich einer Beurtheilung fähig, weil Schiller noch in keiner durchaus gelungen ist, u. sich selbst Gnüge gethan hat; allein selbst, wenn diese Gattungen vielleicht gar nicht überhaupt einer Vollendung fähig wären, was ich doch nicht glaube, so würde der Kopf immer höchst merkwürdig bleiben, der so durch eine Einzige Verstandeshandlung alles Höchste im Menschen, Phantasie u. Vernunft, die Freiheit von jener u. die Nothwendigkeit dieser zu vereinigen strebt.
Da Sie, wie ich aus Ihrem Briefe sehe, mit mir über Schiller noch gar nicht einerlei Meynung sind, so werden Sie unmöglich meinen Sinn im Vorigen ganz gefasst haben, oder wenn ich deutlich genug gewesen wäre, mir doch nicht beistimmen. Indess war es nothwendig, diess vorauszuschicken, wenn wir uns mit einander über Schiller u. vorzüglich über das Problem: wie Empfindung u. Phantasie sich in ihm zu einander verhalten? verständigen wollen.
Wenn Sie eigentlich über Schiller ins Reine zu kommen wünschen, so gestehe ich zuerst, dass der Don Karlos der unglücklichste Eingang dazu ist. Im Ganzen halte ich diesen bei weitem nicht für sein gelungenstes Werk. Er hat mehr als alle übrigen eine gewisse Kälte, ist durchaus raisonnirend, u. eine Zwittergattung, die Schiller jetzt schwerlich noch einmal wählen würde. Um nun zuerst zu fühlen u. sicher zu seyn, welche Kraft Schiller besitzt muss man an die Räuber u. Fiesko gehen; dann allenfalls zum Karlos, aber besser zu den späteren lyrischen Gedichten u. endlich zu den philosophischen Schriften.
Ich wünschte, Sie hätten Sich ein wenig mehr über den Carlos u. vorzüglich über die Briefe über ihn verbreitet, damit ich mich genauer an Ihre Meynung anschliessen könnte. Dass der Karlos u. Schiller überhaupt ganz u. gar unnaiv sind, u. dass Schiller, was er aufstellt, aus seiner Seele schaft, sind gewiss sehr richtig aufgefasste Züge. Aber einen „Hang die Empfindung aufzublasen oder zu übertreiben“ gestehe ich, finde ich nicht, und Ihr Bild von den Oefen kann ich daher gar nicht adoptiren. – Ueber Nichts dünkt mich, ist es so schwer abzusprechen, als über das Maass der wahren u. überspannten Empfindung, der Natur u. der Unnatur, der Nüchternheit u. der Trunkenheit. Diess Maass wechselt meinen Erfahrungen nach ganz erstaunlich nach individuellen Verschiedenheiten. Wie unwahr erscheint uns die französische tragische Bühne, u. wie wahre Thränen hat sie sicherlich dieser Nation entlockt? Mit der Englischen ist es derselbe Fall, u. die Griechische selbst ist, was indess nur wenige so genau wissen, in einem ganz andren Sinne natürlich, als z. B. unser Götz, als Nathan, als selbst Göthe’s Iphigenia. Nicht von Ihnen, glaube ich, aber auf meiner letzten Reise erinnere ich mich sehr wohl das Lied an die Freude unnatürlich oder wenigstens einen Ausdruck trunkner Lust nicht menschlicher Freude nennen gehört zu haben, u. ich mache kein Hehl daraus, dass in der nüchternsten Periode meines Lebens, die sich mit meinem 21sten Jahre endigte, ich es selbst beinah für Unsinn hielt. Nachher habe ich ein andres Urtheil gefällt. Es ist mir nun durchaus natürlich u. wahr, trunken freilich, aber wie der lyrische Dichter es seyn muss. Wir Deutschen nennen gern natürlich, was ganz aus der blossen Wirklichkeit genommen ist. Ohne diess Extrem wären wir, meiner Theorie nach, den Griechen sehr nah. Hiermit will ich aber schlechterdings nicht alle Grenzen entfernen, nicht alles, was je in eines Menschen Hirn gekommen ist, natürlich u. ästhetisch (wodurch doch immer auf Allgemeinheit Anspruch gemacht wird) natürlich finden, auch schlechterdings nicht läugnen, dass Schiller in Einzelnen Stellen würklich übertrieben, obgleich nie aufgeblasen, ist. Nur wollte ich Ihnen zu zeigen versuchen, dass ich glaube, dass man vorher die Art des Gefühls, die Schillern, als Dichter, eigenthümlich ist, bei weitem genauer prüfen u. bestimmen muss, ehe man über Natur u. Wahrheit in ihr entscheiden kann.
Ich bin sehr wortreich geworden, liebster Jacobi. Aber dieser Gegenstand gehört zu meinen Lieblingsmaterien, u. die Vergleichung der Individualitäten der grossen Männer, denen das Schicksal mich glücklicherweise zum Zeitgenossen zugesellt hat, u. die ich persönlich kenne, ist mir die liebste u. intressanteste Beschäftigung in den Stunden eines ruhigen Nachdenkens. Es wäre mir lieb, wenn Sie mir bald sagten, was Sie über das, was ich Ihnen hier von meinen Geständnissen mitgetheilt habe, denken. Dass, was wir uns sagen von beiden Seiten nur unter uns bleibt, darauf können Sie sicher rechnen. – Verzeihen Sie die Unordnung dieses Briefs. Mein kleines Mädchen hat die ganze Zeit neben mir gespielt u. mich oft gestört. Meine Frau grüsst Sie u. die Ihrigen, so wie auch ich, von ganzem Herzen.
Leben Sie innigst wohl.Ihr Humboldt.
Ihren nächsten Brief bitte ich Sie nach Jena, im Hellfeldschen Hause am untern Markt zu addressiren. – Ist
Ihr Max schon da? Wir treffen den 30sten dort ein, u. gehn den 23sten von hier ab. Wollten Sie wohl die Güte haben, die Kleinigkeit zu bezahlen, die wir nach
der Inlage schuldig sind. Auch Stinchen
haben wir an Sie assignirt. Wir wollen uns mit Ihrem Max berechnen.
Fußnoten
- a |Editor| Gemeint ist die Ehefrau von Piter Poel, dem Herausgeber des Altonarischen Mercurius. Der Sohn Ernst, später Jurist und Nachfolger seines Vaters als Herausgeber des Altonaischen Mercurius, wurde am 22. September 1797 in Altona geboren. [FZ]