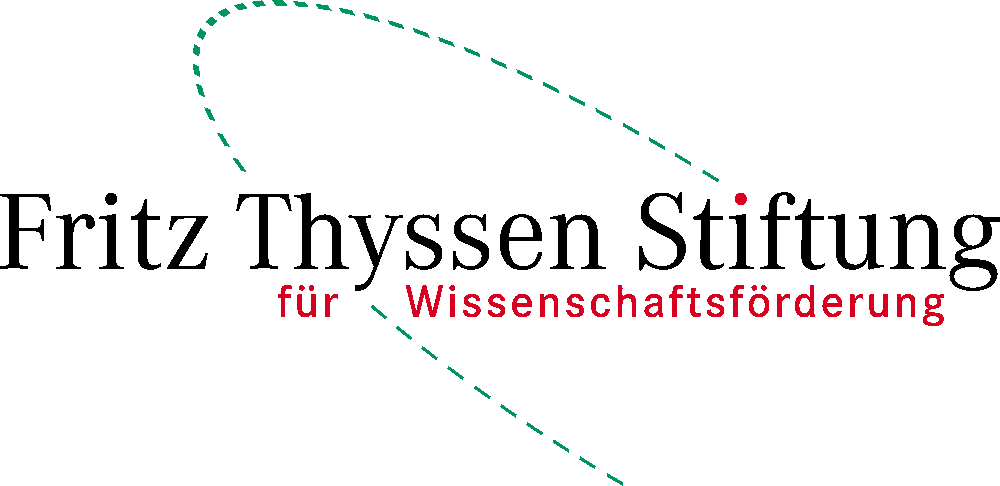August Wilhelm von Schlegel an Wilhelm von Humboldt, 23.–30.07.1821
Bonn den 23sten Julius 21.Ew. Excellenz haben mich durch Ihren so reichhaltigen und aufmunternden Brief vom 5 ten Mai auf die erfreulichste Weise überrascht. Ich empfing ihn in Paris, eben unter der Verwirrung der letzten Besorgungen: diese, dann meine Rückreise und die hier vorgefundenen Geschäfte, sind Schuld an der Verzögerung meiner Antwort, die ich Sie gütigst zu entschuldigen bitte. Einen solchen Brief glaubte ich nicht flüchtig und obenhin beantworten zu dürfen. Ew. Excellenz sind mir eigentlich zuvorgekommen: schon längst hatte ich mir vorgesetzt, Ihnen zu schreiben, und für meine jetzigen Bestrebungen Ihre wohlwollende Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen. Ich betrachte es als eine glückliche Vorbedeutung für das Gedeihen der Indischen Philologie in Deutschland, daß Sie dem Sanskrit Ihre Neigung zugewendet haben. Hätte ich nur in Ihrer Nähe seyn können, um Ihnen die Mühseligkeit der ersten Schritte zu erleichtern! Denn bey Ihrer Stärke in der vergleichenden Sprachkunde und in der allgemeinen Grammatik werden Sie bald oder vielleicht schon jetzt keiner Hülfe mehr bedürfen. Zu der künftigen Annehmlichkeit des Studiums hoffe ich durch die verbesserte Typographie etwas beyzutragen. Vielleicht ist Ihnen mein Specimen zu Gesichte gekommen. Seitdem ist aber fast nichts unverändert geblieben, und ich schmeichle mir, daß das Ganze noch beträchtlich gewonnen haben soll. Alle zur Anlage einer Indischen Druckerey erforderlichen Arbeiten sind unter meinen Augen in Paris vollendet worden, bis auf den Guß, dessen zweckmäßige Ausführung ich durch die früher gegebenen Anleitungen und durch zurückgelassene Modelle gegoßner Lettern hinlänglich gesichert zu haben denke. In kurzem erwarte ich nun den vollständigen Vorrath, und werde dann auf Befehl des Herrn Ministers von Altenstein die Matrizen und Gußformen nach Berlin senden, wo ein zweyter Guß angefertigt werden soll. Wer wird aber dort Herausgeber seyn?
Ich werde nicht säumen, Hand ans Werk zu legen, und gedenke zuerst den Bhagavad-Gîtâ zu drucken. Die Ausgabe von Calcutta ist äußerst selten und schwer zu haben, dazu wie alles dort gedruckte unbequem zum Gebrauch. Die Conjectural-Kritik hat an diesem Werke nichts zu thun: der Text ist in jeder Sylbe rein erhalten. Die Fehler der gedruckten Ausgabe bin ich im Stande durch Vergleichung der Parisischen Handschriften zu verbessern. Die grammatische Auslegung ist leicht; einen philosophischen Commentar muß ich auf die Zukunft versparen, ich habe die einheimischen Ausleger noch zu wenig benutzen können.
Demnächst denke ich an den Hitôpadêsa zu gehen. Mit diesem Buche verhält es sich nun freylich ganz anders: die Handschriften weichen sehr ab, und, wiewohl schon zweymal gedruckt, liegt der Text noch sehr im Argen. Die Vergleichung der einzigen Parisischen Handschrift hat mir schon einen beträchtlichen Vorrath besserer Lesearten geschafft. Das Buch ist wichtig, weil es eine ganze Litteratur voraussetzt. In der Folge wird man, nach Colebrooke’s Rath, auf den Panchatantra zurückgehen müssen[a]: denn da dieser die ältere Redaction jenes Fabelbuches ist, welche unter dem Nuschirvan ins Pehlvi übersetzt worden, und da alle die Schriften, woraus die Sprüche geborgt sind, schon früher vorhanden seyn mußten, so ist keines mehr geeignet, uns zu einer wenigstens negativen Chronologie der Indischen Litteratur zu verhelfen.
In der Folge, wenn mir der Himmel noch einige Jahre Leben und Gesundheit gewährt, möchte ich wohl eine Ausgabe des ganzen Râmâyana veranstalten. An sich ist diese Unternehmung nicht unübersehlich: der bloße Text wird sich in 5 Octavbände bringen lassen. Alle Varianten beyzufügen, das wäre freylich endlos: man muß sich damit begnügen, die von Seiten des Inhalts merkwürdigen anzuzeichnen. Überhaupt darf man sich nicht schmeicheln, einen einzig authentischen Text auszumitteln, was wohl nur bey solchen Werken möglich ist, wovon es fortlaufende alle einzelnen Sätze wiederholende Commentare giebt. Die Handschriften weichen, nach den wenigen Abschnitten zu urtheilen, die ich habe vergleichen können, zum Verzweifeln weit von einander ab. Wir wollen zufrieden seyn, wenn wir einen sprachrichtigen, zusammenhängenden, nicht lückenhaften und nicht auffallend interpolirten Text haben. Es besser zu machen, wie die Herausgeber der beyden ersten Bücher in Serampore, ist allerdings leicht.
So viel von meinen Planen. Jetzt zu Ihren Fragen, die ich versuchen will, so gut ich weiß und kann, zu beantworten. Der status absolutus der Substantive und Adjective ist meines Bedünkens keinesweges eine Fiction der grammatischen Theorie, sondern eine Thatsache: denn er ist, mit wenigen Ausnahmen die Gestalt, worin das Wort in den compositis erscheint. Ich finde vielmehr hier ein großes Misverständniß in der Lehre der Griechischen und Lateinischen Grammatiker, welche den Nominativ für das nackte Wort selbst nehmen, und keine notam nominativi anerkennen, welche doch offenbar vorhanden ist. Und zwar ist die nota nominativi im mascul. bey den Griechen in der ersten zweyten und dritten Declination, in dieser auch im femin. ein Σ; eben so im Lateinischen mit Ausnahme der ersten Declination, in welcher es wohl keine andre masculina giebt als Etruskische Namen und Wörter. Dieß ist sehr wichtig für die Verwandtschaft der Sprachen: im Indischen, Griechischen, Lateinischen, Gothischen, und nach Herodot auch im Altpersischen ist das S allgemeines Kennzeichen des Nom. im mascul., zuweilen auch im femin. – Das visarga ist nur eine flüchtigere Aussprache, wie ja auch die Römer poplu gesagt haben. Im Etruskischen ist dieses Wegwerfen des ohne Zweifel ursprünglichen s allgemein (Hercle, Vtυχe), und ich glaube im Homer noch Spuren zu finden (νεφεληγερέτα Ζεὺς – ἱππότα Νέστωρ) daß es vor Alters im Griechischen in gewissen Fällen gleichfalls gebräuchlich war. – Mich dünkt, dieß ist auch schon von den Etymologen durch die That anerkannt worden: man weiß daß man nicht αἴξ, mons, u. s. w. abzuleiten hat, sondern ΑΙΓ-ος, MONT-is. Im Neutrum ist die nota nominativi ein n oder m, wie im Indischen ebenfalls.
Mit der Wurzel der Zeitwörter verhält es sich etwas anders: sie gehört zwar der Theorie an, ist aber doch keine Fiction. Es ist eine Darlegung der Grundbestandtheile, woraus alle Verwandlungen und Entwickelungen des Wortes wie aus ihrem Princip begriffen werden können. Irgendwo pflegt doch auch die Wurzel als Bestandtheil unverändert zum Vorschein zu kommen. Wenn wir im Griechischen und Lateinischen auf einen grünen Zweig kommen sollen, ich will nicht sagen mit der Etymologie, sondern selbst mit der grammatischen Analyse, so werden wir es auch versuchen müssen, Wurzeln der Zeitwörter aufzustellen, wiewohl den alten Grammatikern dieser Begriff ganz fremd ist. Das praes. indicat. hat sie noch schlimmer irregeführt als der nom. sing., indem sie beydes für das Wort selbst nahmen.
Die Sautradhâtu’s, die Uṇadi-Affixe, sind allerdings der Theorie zu Liebe ersonnen. Sonst aber haben, wie mich dünkt, die Indischen Grammatiker, bey Aufzählung der Wurzeln, die Thatsache des Sprachgebrauchs mit größter Gewissenhaftigkeit aufgefaßt. Sie unterscheiden das nahe Verwandte, und nehmen verschiedene Wurzeln an, wo nur eine Modification der Bedeutung, der Flexion, oder der Aussprache Statt findet. Manches möchte ich nicht für wahre Wurzeln gelten lassen, zB. alle Zeitwörter, die bloß nach der 10ten Conjugation gehen, denn diese ist meines Erachtens nichts andres als das caussativum.
In Absicht auf die tempora und modos muß man wohl eingestehen, daß die Griechische Sprache sich reicher und mannigfaltiger als die Indische entwickelt hat. Sie verdankt dieß wohl zum Theil den Revolutionen, welche sie erlitten, und denen im Indischen durch frühe Feststellung vorgebeugt ward. So scheinen mir zB. der Griechische Optativ und Conjunctiv ursprünglich nur zwey verschiedene Exemplare derselben Sache zu seyn: der Optativ ist von der älteren Form in μι abgeleitet, auf eben die Weise wie der Conjunctiv von der jüngeren Form ω, εις, ει. Nachher ist dieß freylich zu feineren Unterscheidungen benutzt worden. Übrigens haben die Indier bey ihrem eigenthümlichen Gedankengange doch noch Überfluß, denn verschiedne Biegungsarten kommen äußerst selten vor. Die tempora des Indicativs sind allerdings vollständig bis auf das plusquamperfectum, Wilkins hat sie nur falsch benannt, wie er überhaupt in seiner Terminologie meistens unglücklich ist. Diese Zeiten sind: praesens, imperfectum, praeteritum, perfectum, aoristus und zwey futura, ein remotum und ein proximum. – Das Sanskrit, das Lateinische, die meisten Sprachen haben nur Einen Imperativ: der Natur der Sache nach scheint es nicht mehrere geben zu können. Die Griechen haben drey oder vier Imperative. Was machen sie damit? Ich finde keine Sylbe hierüber in Matthiae’s weitläuftiger Grammatik. Man muß es wohl eingestehen, der grammatische Bildungstrieb kann auch apokryphische Zeugungen ans Licht fördern, und dieß scheint wirklich in der Griechischen Sprache zuweilen geschehen zu seyn. – Die Form, welche Wilkins den potentialis nennt, gebrauchen die Indier auf die umfassendste Weise, als dubitativus, concessivus, optativus, exhortativus etc. Statt des eigentlichen coniunctivus, d. h. um die Abhängigkeit von einer Bedingung auszudrücken, setzen sie häufig den indicativus mit einer Partikel; z. B. statt cura ut fiat: cura quomodo fiet. Den precativus sollte man lieber optativus nennen. Auch der Aoristus wird mit der particula averruncandi als ein verneinender Optativ gebraucht, freylich mit Weglassung des Augments. Übrigens können die fehlenden tempora, das plusquamperfectum des Indicativs, und beym Conjunctiv alle näheren Zeitbestimmungen allerdings durch paraphrastische Conjugation, nämlich durch ein Participium mit einem Hülfsworte, ersetzt werden. cf. Wilkins p. 656.
Über die Tonstellung kann ich Ihnen für jetzt noch keine Auskunft geben. Die Kunstwörter acutus, gravis, circumflexus stehen gleich zu Anfange des Siddhâṇta Kaumudi; welche Sylben aber diese verschiedenen Bestimmungen erhalten, darüber habe ich, die Regeln noch nirgends gefunden. Das mit den Veda’s ist meines Erachtens anders zu verstehen, nämlich als eine Art von canto fermo, Hebungen und Senkungen der Stimme nach ganz musikalischen Intervallen, womit der Überlieferung gemäß die heiligen Bücher vorgetragen werden sollen. Auf ähnliche Art hat unser Otfrid seine Lieder accentuirt: die Accente treffen immer mit den grammatischen zusammen, stehen aber nur da, wo die Stimme die Höhe erreicht, und sich wieder zu senken anfängt. Wenn die Indischen Grammatiker über die Tonlegung schweigen (was ich jedoch nicht weiß), so behandeln sie das Sanskrit nur allzu sehr als eine lebende Sprache, worin das Gefühl hiefür nicht durch Regeln geleitet zu werden bedurfte. Haben die Griechen sich doch auch erst mit den Accenten bemüht, als ihr διάλεκτος κοινή eine gelehrte Büchersprache zu werden anfing. Die Römer schrieben aus Nachahmung der Alexandriner zur Zeit des Quinctilians das Lateinische mit Accenten, haben es aber nachher wieder vernachlässigt. Raffles hat bey den Wörtern der Javaner Dichtersprache, welche meistens reines Sanskrit sind, nicht die Quantität der Vocale, sondern den Wortaccent bezeichnet, der dann oft auf die Kürze fällt. Ob es im Sanskrit eben so war und ist, kann ich nicht sagen. Den majestätischen Wortlaut der Sprache im Munde der Brahmanen haben mir Engländer oft gerühmt.
Aus Calcutta wird uns eine abgekürzte und vereinfachte Grammatik des Sanskrit von einem Englischen Geistlichen, Namens Yates, angekündigt. Mir misdünkt daran die Schreibung Sunskrit, aber die Engländer sind hierin fast unheilbar. Ich weiß nicht, wo es Nyerup hergenommen hat, daß ich die Indischen Grammatiker als Subtilitäten Krämer geringschätze. Ich hege für sie eine gränzenlose Bewunderung, und wollte nur, ich verstände sie erst vollkommen. Ich zweifle nicht, es wird Ihnen einen großen Genuß gewähren, in der Folge an die Originalwerke dieser wissenschaftlichen Köpfe selbst zu gehen, da Sie gewohnt sind, schwere Räthsel aufzulösen.
Bey der Indischen Litteratur hat man eine breite Wahl. Wem die Purâṇa’s nicht zusagen, der findet vielleicht mehr Geschmack an der kunstreichen Poesie aus dem Zeitalter des Kalidasa, welcher auch Colebrooke den Vorzug giebt. Ich habe Chezy ganz in Entzücken verlassen über den Amaruṣataka, eine Sammlung erotischer Epigramme oder Idyllien.
Meine Herabkunft der Göttin Ganga habe ich nicht eigentlich für eine Übersetzung ausgegeben. Ich wollte die alte Dichtung dem Inhalte und Charakter nach treu nacherzählen, sonst aber auf meine Weise und in schon einheimisch gewordnen und ansprechenden Formen. Zu wörtlichen Übersetzungen der alten epischen Poesie kann ich überhaupt nicht rathen, theils wegen der Variationen des Textes, theils wegen der unendlichen Wortfülle, die im Original immer mannigfaltig, tönend und geflügelt ist, bey unsrer Armuth aber unvermeidlich in leidige Wiederholungen ausartet. Die Versuche von Bopp und Kosegarten sind abschreckende Beyspiele.
Erlauben mir Ew. Excellenz noch eine Bitte. Ich wünsche zu erfahren, wie viel und was für Handschriften in der Propaganda zu Rom befindlich sind? Vorzüglich auch in was für Schriftarten? Ich befürchte, meistens Talinga, Tamul pp, da ich nur Dêvanâgari und Bengali brauchen kann. Sie könnten mir vielleicht zu einer Nachricht hierüber verhelfen. Ich mag mich nicht an Niebuhr wenden, weil ich höre, daß er wegen meiner Recension nicht freundlich für mich gesinnt ist.
Ihre Schrift, die ich doppelt erfreut bin, als ein Ehrengeschenk aus Ihrer Hand zu besitzen, führt uns um einen sichern Schritt vorwärts in der alten Völkerkunde. Einer so angestellten Untersuchung zu folgen, ist für mich ein wahrer Genuß, auch unabhängig von dem Ertrage. Noch habe ich die Schrift erst Einmal gelesen, und wage es kaum, Ihnen eine und die andre Bemerkung und Frage vorzulegen. Davon haben Sie mich nun wohl überzeugt, daß das Vaskische eine alte und ächte Sprache ist: daß Sie es dafür halten, ist mir am Ende Beweises genug. Aber sobald sich Ähnlichkeiten mit benachbarten Sprachen kund geben, kann ich dem Verdachte nicht widerstehen, sie möchten nicht ursprünglich sondern durch fremde Einmischungen entstanden seyn. Denn diese ließen sich wohl schwerlich vermeiden bey einem unlitterarischen Völkchen, das lange Jahrhunderte ohne schriftliche Denkmale seiner Sprache von überlegenen Nationen in einen Winkel zurückgedrängt lebte. Dieß ist auch meine allgemeine Ansicht vom Wallisischen und Niederbretagnischen. Z. B. campoan ist mir verdächtig als romanischen Ursprungs. Wir haben ja auch échapper, scampare von ex-campare. Also campoan, mit einem einheimischen Suffixe, in campo, auf dem Felde, draußen. In dem Fragment eines alten Gedichtes im Mithridates bemerkte ich mehrere dieser Art. Eine Untersuchung über die Zustände und Verhältnisse, worin die Vasken zwischen Gothen, Arabern, Franken und Römischen Provinzialen das Mittelalter hindurch gelebt haben, wäre eine willkommene Zugabe. Im Norden der Pyrenäen erscheinen sie erst in der letzten Hälfte des Merowingischen Zeitraums, und sind wohl eingezogen als die Westgothen diese Wohnsitze zum Theil geräumt hatten. Wo ich nicht irre, führen ihre Heerführer beym Fredegarius zuweilen Deutsche Namen. Da ganz Gascogne von ihnen den Namen führt, wo doch großentheils romanisch gesprochen wird, so muß hier wohl eine Vermischung der Stämme vorgegangen seyn. Und sollte dieß gar nicht auf die Sprache der Spanischen Vasken zurückgewirkt haben? Schreibt sich nicht auch aus diesen Gegenden der Name der cagots her, welcher nach der Etymologie nichts anders bedeuten kann, als Gothische Hunde, d. h. vermuthlich Arrianisch gebliebene Gothen? – Es wäre nun eine schöne Arbeit zu machen, die sich an die Ihrige anschließen würde, nämlich im ganzen Vorrath der Spanischen Sprache die Wörter auszusondern, die nicht Lateinisch, nicht Gothisch, nicht arabisch, sondern Vaskischen Ursprungs sind. Ohne Zweifel sprach man zwar, als die Sueven, Vandalen und Gothen eindrangen, in ganz Spanien, die nordwestlichen Küstenländer ausgenommen, Lateinisch; aber in das Romanische der Bauern konnten sich Wörter aus der Ursprache eingemengt haben.
Mit den Lateinischen Wörtern, welche Sie aus dem Vaskischen herzuleiten geneigt sind, möchte ich wohl noch einen Versuch wagen, eine einheimische Wurzel auszumitteln. Cūria a coëundo.[1] Dem Sinne nach wie comitium. Coetus und coïtus eben daher. Wohl zu merken, daß die Römer vor Alters kein o hatten, das letzte Wort also zumal cuitus geschrieben wurde. – Mons a movendo, wie pons a ponendo, fons a fundendo. Wir haben auch momentum statt movimentum. Moveo ist eine abgeleitete Form, movi zeugt von der ursprünglichen, Μάω vor Alters ΜΑϝΟ. Mons ware also das Emporstrebende.
Murus, eine Einfassung, Begränzung, Scheidung, ἀπὸ τοῦ μείρειν. In pomoerium erkennen wir die alte Form moerus (wie µοῖρα) oder vielmehr nach dem Etruskischen Alphabet MVIRVS oder MVERVS. Das ursprüngliche Zeitwort ist verloren, aber in der abgeleiteten Form mereri, seinen Antheil bekommen, ist noch die Bedeutung des Griechischen nachzuweisen.
Für Vertere weiß ich kein Griechisches Analogon, wohl aber ein Indisches ganz genau entsprechendes: vrit, 3 p. praes. vartati, vertit. Dann das Gothische: vairthan, woher vairths, versus. Das Wort ist also genugsam als einheimisch beurkundet, da es sich in dreyen der zu dieser bekannten Familie gehörigen Sprachen findet. – Wahrscheinlich war es auch in der Etruskischen Sprache, wenn der Gott Vertumnus nicht bey der Verpflanzung nach Latium seinen Namen verändert hat, was nicht wahrscheinlich ist, da die Endung (das part. praes. medii oder passivi) auch an andern Etruskischen Götternamen vorkommt.
Über vrbs weiß ich für jetzt nichts, als was Varro und Festus sagen. – Sollte das Vaskische cillarra nicht eher von dem Gothischen silubr herkommen, als umgekehrt? Fremd klingt das letzte freylich, und dieß ist bey Metallnamen häufig der Fall, begreiflicher Weise; aber sehr frühzeitig muß das Wort doch den Stammvätern der deutschen Sprachen zugebracht seyn, da es sich, soviel ich weiß, in allen Mundarten findet. – Das Spanische izquierdo scheint ausgemacht von dem Vaskischen Ezquerra herzukommen. Aber ich möchte von beyden eine Deutsche Ableitung versuchen: twerch, obliquus; im Gothischen hieß es vermuthlich: thvairh. Die Benennungen der linken Hand pflegen immer von solchen Bildern hergenommen zu seyn. – Das in Ihrem Glossar daneben stehende ezquilla ist unläugbar Germanisch-Romanisch. Im Italiänischen squilla; unser Schelle von schallen. Landa, das Feld, ist auch Deutsch – beym Ammianus caucalandia, Gothisch hauhaland, das hohe Land (Siebenbürgen); ganz in der Nachbarschaft der Vasken ist der Name les landes, wie zum Andenken der Gothischen Bewohner stehen geblieben.
Sie sehen, welche Gefahr dabey ist, wenn man einem Etymologen die Schleusen seiner Liebhaberey aufzieht. Ich verschone Sie mit dem übrigen. Nur, da Sie bemerken, daß der Vaskischen Sprache, wie den Americanischen das F fehlt, will ich hinzufügen, daß mir eben dieß schon an der Sprache der Gallier aufgefallen ist. Ich erinnere mich, bey allen Orts- und Personennamen und andern Wörtern nur eine einzige Ausnahme gefunden zu haben, die eben deswegen verdächtig ist. Auch die andern adspiratae θ und χ fehlen. Dieß macht einen schneidenden Gegensatz mit dem Deutschen Sprachstamme.
Italien berühren Sie nur im Vorbeygehn: ich möchte Sie wohl um nähere Erörterungen Ihrer Ansicht bitten. Aus Hellenischen Colonien läßt sich die Verwandtschaft der Alt-Italischen Mundarten mit dem Griechischen nicht erklären; diese Colonien sind alle sehr jung; die Trojanischen und Vortrojanischen sind mera Graeculorum somnia; unter den historischen sind auch die Annalen von Cumä apokryphisch. Dieß geht in eine weit höhere Vorzeit zurück, vor der Trennung der Italischen und Pelasgischen Stämme. Wie hätte sich sonst in Italien so viel rein-Indisches erhalten, was in Griechenland erloschen ist? Sind Sie nicht auch der Meynung, daß es in Italien, die späteren Ansiedelungen abgerechnet, nur zwey Hauptsprachen gab, die Etruskische, und die andre, nur in verschiedenen Mundarten, Umbrisch, Lateinisch, Sabinisch, Oscisch, Siculisch durch die ganze Halbinsel hindurch bis tief in Sicilien hinein? Mich dünkt, dieß geht aus allen Ort- und Personennamen, einzelnen Wörtern, Inschriften u. s. w. hervor. Das Etruskische rechne ich freylich auch zu derselben Familie, aber es steht viel weiter abwärts. In keinem Stücke habe ich Niebuhrs Werk unbefriedigender gefunden als in Beziehung auf die Sprachen. Ich habe ehemals viel über diese Sache gesammelt, aber ich weiß nicht, ob ich jemals dazu kommen werde, meine Origines Italiennes zu schreiben. Lanzi’s Buch[b] ist doch am Ende die einzige Vorarbeit, die wir bis jetzt haben. Wer schreibt uns ein Italisches Onomasticon? und ein Buch über die Geographischen Namen Italiens wie das Ihrige über Spanien? Wenn ich nur Zeit hätte, so dächte ich wohl den Iguvinischen Tafeln völlig auf den Grund zu kommen. Es bleibt doch eins der merkwürdigsten Denkmäler des Alterthums.
Es ist mir unendlich freulich, daß Sie den Bau meiner Hexameter im Ganzen billigen. In der Theorie möchte ich schlecht bestehen: ich glaube wohl den Grund von diesem und jenem zu errathen; aber ich begnüge mich damit, die Praxis der Alten genau zu bemerken und dann mein Gehör zu Rathe zu ziehen. – Von den Gesetzen der Quantität in unsrer Sprache glaube ich hingegen ziemlich genaue Rechenschaft ablegen zu können. Die Abstufung unsrer Längen und Kürzen, und ihre Wechselbestimmung wird anerkannt; die Einwirkung des vorwaltenden Rhythmus, und gewisser Stellen im Verse ist vielleicht noch nicht gehörig entwickelt worden. Bey der Worttheilung müssen die anhängenden Redetheilchen in Betracht kommen: denn wir haben deren, sowohl vorangehende als nachfolgende, wiewohl weder bey Klopstock noch bey Voß davon die Rede ist. Dieß ist um so weniger zu verwundern, da auch unsre meisten Hellenisten keine anschauliche Vorstellung von der Sache haben. Ich wenigstens habe erst durch die Aussprache der Neugriechen erfahren, was eine particula enclitica ist. – Beyden Gemahlinnen, das ist gerade wie mollis amaracus; Stammhalter zu seyn | des Geschlechtes; hier wird, wie mich dünkt, eben durch die Inversion, das zu seyn mit großer Gewalt zu dem vorhergehenden gezogen. Was die unerlaubte Tmesis im vierten Daktylus betrifft, so können wir es schwerlich dem Homer gleichthun: wenn wir nur einen durch den Sinn gebildeten Abschnitt vermeiden, so können wir uns auf das Beyspiel der Lateinischen Dichter berufen. Auf mir lastet. Mir ist entschieden lang durch die Emphase, es wäre also natürlicher Weise ein Antispast; aber auf wird lang durch die erste Arsis des Hexameters, wo jedes einsylbige Wort, das nicht eine particula enclitica ist, lang werden kann. In aufwallendem Zorn ist meines Erachtens ein richtiger Hexametrischer Anfang. Bey der Mittelzeit, wo die grammatische Bedeutsamkeit nicht so herrschend entscheidet, tritt als untergeordnetes Princip das materielle Gewicht der Sylben, die Dehnung der Vocale, und in gewissen Fällen die Position hervor. Dieß möchte ich noch mehr geltend machen als bisher geschehen ist. Alle Präpositionen, selbst in und an können lang werden: auf, aus, vor möchte ich durchaus nicht als Kürzen gebrauchen; nun vollends durch, welches eigentlich aus zwey Sylben, thuruh, zusammengezogen ist. Irgendwo müssen wir diese verwünschten mittelzeitigen Wörtchen doch hinschieben, und ich will mir lieber unvollkommne Längen gefallen lassen, als erzwungene Kürzen. In der letzten Hinsicht sind mir Vossens Hexameter noch viel zu hart. Er hat die Sache allerdings vorwärts gebracht, aber nun möchte er sie gern auf dem Punkte festhalten, über welchen er nicht hinaus gekonnt hat. In seinem Buche über die Zeitmessung zeigt sich praktische Fertigkeit, zugleich aber eine völlige Abwesenheit der Gedanken. So weiß er zB. nicht zu erklären, warum un zuweilen kurz und unbetont ist, andremale die Länge und den Ton bekommt. Und doch war der Unterschied ganz logisch zu fassen: sind die Begriffe contradictorie entgegengesetzt, so bleibt un kurz; sind es hingegen contrarie opposita, wird die Verneinung positiv, so wird es lang.
Ihren Bruder habe ich recht wohl und heiter verlassen: noch kurz vor meiner Abreise speisten wir sehr vergnügt zusammen im Palais royal. Er hat mir versprochen, mir etwas für die Indische Bibliothek zu geben: wenn er nur Wort hält! Die gleiche Bitte möchte ich an Ew. Excellenz wagen. Es liegt so manches in dem Umfange Ihrer Untersuchungen, was in den Kreis meiner Zeitschrift gehört, und wenige Seiten von Ihrer Hand würden für mich ein Geschenk vom größten Werthe seyn. Ich werde die Muße der nächsten Ferien sogleich für das dritte Heft benutzen. Es wird bald einmal ein großer Artikel Berichtigungen nöthig seyn, denn es wird in Deutschland Mode, daß die Crethi und Plethi nicht nur von den Indischen Alterthümern sondern auch vom Sanskrit schwatzen, ohne ein Wort davon zu wissen. – Ich werde nicht umhin können, gegen die Vorhalle des wackern Ritter vieles einzuwenden; unmöglich kann ich seinen vorbrahmanischen Buddhaismus durchgehen lassen. Daß Wolf günstig für mich gesinnt ist, habe ich mit großer Freude erfahren: ich fürchte nur, ich werde bald einmal alles durch das Digamma verderben, wiewohl ich es damit nicht so wie Knight zu machen hoffe.[c]
Dießmal habe ich in Paris Bekanntschaft mit Abel Remusat gestiftet, der ohne Zweifel einer der tüchtigsten Sprach- und Geschichtforscher in Europa ist, und dessen Untersuchungen die meinigen ganz nahe berühren.
Die Zahl der vollgeschriebenen Blätter erinnert mich daran, Ihre Geduld nicht auf eine zu starke Probe zu stellen. Der Empfang Ihres Briefes vergegenwärtigte mir lebhaft, welche Mittheilungen und Anregungen ich dadurch einbüße, daß ich nicht in Berlin lebe. Mich fesselt hier der schöne Rhein, die mildere Luft, die fast ländliche Ruhe und Beschränktheit und dann die günstige Lage für mancherley Reisen; nun auch schon die Gewohnheit und die Scheu vor einer neuen Einrichtung. Doch ist meine schließliche Ansiedelung hier noch nicht höheren Orts entschieden, und ich habe meinerseits Berlin nicht ganz aus den Augen verloren. Auf jeden Fall hoffe ich bald einmal wieder mit Ihnen zusammenzutreffen, wie ich ja schon in so manchen Städten und Ländern das Glück hatte. Ich bitte Sie mich Frau von Humboldt [zu empfehlen][d],
und bin mit der ausgezeichnetsten VerehrungEw. Excellenz
gehorsamster
AWvSchlegel.
den 30sten Julius 21.
Fußnoten
- 1 |Schlegel| Nicht etwa von dem Infinitiv ire; das r gehört zur Derivationsform, wie in centu-ria.
- a |Editor| Zu Colebrookes Vorschlag siehe seinen Brief an Schlegel vom 31. Januar 1821: Rosane Rocher / Ludo Rocher (2013): Founders of Western Indology. August Wilhelm von Schlegel and Henry Thomas Colebrooke in Correspondence 1820–1837, Wiesbaden: Harrassowitz, S. 45f.; ebenda Anm. 96 zitiert diese Stelle des Schlegel-Briefes an Humboldt. Siehe zudem ebenda S. 48 Anm. 106. [FZ]
- b |Editor| Bei dem genannten Werk handelt es sich wohl um Lanzis Saggio di lingua Etrusca e di altre antiche d’Italia per servire alla storia de’popoli, delle lingue, e delle Belle Arti, Band 1–3, Rom: Pagliarini 1789, der sich nachweislich in Schlegels Besitz befand, s. Dresden, SLUB, Mscr.Dresd.e.90, XV, "Verzeichniß meiner Bücher im December 1811", S. 73 Nr. 727–729. Der ominöse Saggio delle lingue d’Italia von 1806, der nur in Biographien Lanzis genannt wird, ist anderweitig nicht nachweisbar. [FZ]
- c |Editor| Siehe hierzu Richard Payne Knight (1820): Carmina Homerica, Ilias et Odyssea, a rhapsodorum interpolationibus repurgata, et in pristinam formam, quatenus recuperanda esset, tam e veterum monumentorum fide et auctoritate, quam ex antiqui sermonis indole ac ratione, redacta, London: in ædibus Valpianis.
- d |Editor| Einfügung Leitzmanns.