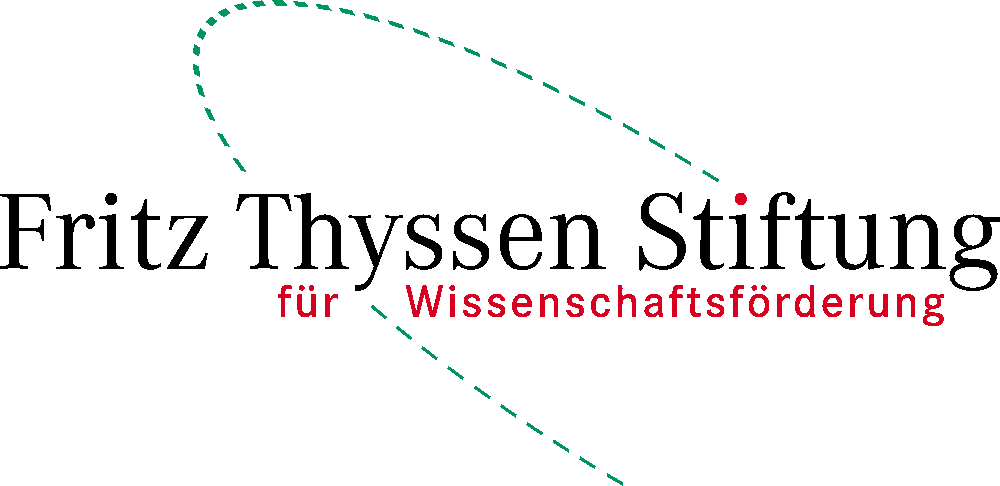Wilhelm von Humboldt an Friedrich Gentz, 09.01.1792
Wenn ich neulich, lieber Gentz, die Französische Konstitution nur als eine Veranlassung brauchte,[a] allgemeine Ideen über alle Staatsreformen überhaupt gelegentlich daran zu entwikkeln; so habe ich sie seitdem zu einem angelegentlicheren Gegenstande meines Nachdenkens gemacht, und da sind mir vorzüglich zwei Betrachtungen aufgestoßen, die, wie mich dünkt, diese Konstitution noch weit von dem Ruhme eines Vernunftideals entfernen, in dessen ruhigem Besiz mein voriger Brief sie ließ. Wenn ich aber meinen Ideen mistraue; so mistraue ich noch mehr meiner Sachkenntniß, und in dieser doppelten Rüksicht bitt’ ich Sie um Berichtigung meines Raisonnements.
Bei der Beurtheilung jeder Staatsverfassung muß man, dünkt mich, sorgfältig zwei zu oft verwechselte Dinge unterscheiden, den Zwek, den sich die ganze Staatsverfassung überhaupt zu erreichen vorsezt, und die Mittel, welche sie verwendet um sich selbst ihr Dasein und die Möglichkeit ihrer Thätigkeit zu erhalten. Von dem ersteren ist in vielen Verfassungen, und z.B. in den alten griechischen und Italischen gar die Frage nicht. Ob in Sparta, Athen, und Rom bloß die Sicherheit abgezwekt wurde, oder auch das übrige Wohl der Menschen, ob in diesem Fall ihr moralisches, oder physisches? möchte nicht bloß eine schwer, sondern eine gar nicht zu entscheidende Frage sein. Sehr natürlich auch. Solange es die Menschen waren, die sich einen Herrscher gaben, so konnte es ihnen nicht einfallen zu fragen, was wollen wir nun anfangen, wenn wir frei und wenn wir sicher sind, aber wenn der Herrscher die Menschen unterwirft, dann ist es nicht befremdend, daß entweder die Menschlichkeit des Regenten sich selbst die Frage vorlegt, welche Gränzen er wohl seiner Wirksamkeit sezen darf? oder daß die Menschen selbst es wagen, ihn an diese Gränzen zu erinnern. Die Bereicherung des Staatsrechts mit dieser Frage dürfte daher in eben die Zeiten fallen, in wel-chen, statt daß ehemals die Freien einen Herrscher verlangten, der Herrscher Sklaven suchte, und in die Zeiten, wo aus den Bürgern Unterthanen wurden. Auf der andren Seite war in den älteren Staaten die Frage, wie man der Regierung Festigkeit und Gewalt zusichern wollte, noch ungleich interessanter, als jezt. Denn in einem Zeitalter, wo der geringere Grad der Kultur und die weniger ausgebreitete Kommunikation es noch weniger möglich macht der wirklichen Kraft nur Zeichen der Kraft, und dem gegenwärtigen Widerstande auf die Zukunft weisende Furcht und Hofnung entgegenzusezen, wo es gilt, was die Menschen sind, und nicht, was sie haben, da muß es, weil der höchst mögliche Unterschied der Kräfte gegen den höchst möglichen Unterschied der Güter natürlicherweise unendlich klein ist, da, sag’ ich, muß es bei weitem leichter sein, einen Thron umzustoßen, als zu behaupten. Wie nahe diese Verschiedenheit zweier Epochen sei, welche offenbar in der Geschichte der Staatsverfassungen, wenn gleich mit großen Verschiedenheiten des Orts und der Zeit, existirten, zeigt die Bemerkung, daß in beiden Epochen völlig gleiche Erscheinungen sich bloß durch diese zwiefache Quelle unterschieden. In den älteren und neueren Staaten wachte man über die Aufrechthaltung der hergebrachten Religionen, in beiden gab es öffentliche Erziehungsanstalten, in Platons Republik[b] und in mehr als Einem neueren Lande sucht man den Handel von der Nation an den Staat zu bringen, und allgemein in alten und neuen Staaten schränkt man die freie Willkühr des Menschenlebens ein, aber weder in den alten sagte man, daß dieß auf die Beförderung des physischen und moralischen Wohls der Bürger abzwekke, noch in den neueren, daß es die Vermeidung von Aufruhr zur Absicht habe. Der einzige Einwurf hiegegen möchte von dem „sagt man“ herzunehmen sein, allein den kann ich hier, wo es mir nicht auf historische, sondern politische Erörterung ankommt, leicht übergehen.
Ueberhaupt, wie auch überall mag gehandelt worden sein; so ist gewiß, daß die beiden gleich anfangs erwähnten Gesichtspunkte – der eine sowenig als der andre – vernachlässigt werden dürfen. Der ganze Unterschied besteht nur darin, daß der eine bloß einen positiven, der andre einen negativen Gebrauch hat. Die Menschen wollen in Gesellschaft leben. Dazu führt sie ihre Natur. In der Gesellschaft aber fühlen sie das Bedürfniß gemeinschaftlicher Führung. Nun entstehen natürlich die beiden obigen Fragen: 1., was verlangt man von der Regierung, und worauf schränkt man ihren Zwek ein? 2., wie bringt man es dahin, daß die Regierung nie mehr thun wolle, aber dieß immer thun könne? Ich fange zuerst bei der lezteren an, weil, wenn ich meine Data über die Französische Konstitution überschlage, mein Reichthum hier größer ist, und auch diese Frage – bei einer genaueren Abmarkung der Wissenschaften – wohl allein eigentlich in die Politik gehört, indem die andre, mehr aus der Moral oder dem Naturrecht geschöpft, der Politik nur die Gränze sezt.
Montesquieus principes haben mir immer eine der genievollsten Ideen geschienen. Sie deuten gerade das an, was ich hier meine, die Nothwendigkeit gleichsam dem unkörperlichen Ideal einen Körper zu leihen, damit es den Menschen sichtbar werde. Unstreitig ist seine Aufzählung oberflächlich und unvollständig. Aber dieser einzige Mann sucht die Ideen nicht auf; sie begegnen ihm, und der geistvolle Leser schämt sich die Geburten seines Genies erst systematisch zu reihen. Sobald man das Band zwischen dem Staat und der Nation fest knüpfen will, sind zwei Klippen zu vermeiden, dem Staate nicht zu wenig Gewalt zu verleihen, damit er sicher wirken könne, und nicht zu viel einzuräumen, damit er die Gränzen nicht überschreite. Daher ist es nie weise, ein wirkliches Uebergewicht physischer Macht zu veranlassen, wie es in allen despotischen und selbst – durch die stehenden Armeen – in unsern monarchischen Staaten ist. Weni ger schlimme Folgen hat es schon, wenn die Macht nicht unmittelbare, sondern mittelbare durch Gewinnung der Nation, oder eines Theils derselben ist. So bei der Ehre, dem principe der Monarchie, nach Montesquieu. Denn dieselbe Ehre, welche die Nation an den Thron bindet, verhindert sie auch, sich als Sklavin behandeln zu lassen. Könnte diese Triebfeder ihrer Natur nach auf alle Mitglieder der Nation wirken; so möchte sie – insofern man nemlich bloß den politischen Gesichtspunkt der Festigkeit der Verfassung faßt – vielleicht die beste sein. Aber da sie allemal nur einen Theil der Nation umfaßt; so kann nur der sie billigen, dessen Sorgfalt um den Ueberrest ganz unbekümmert ist. Wie daher die lezte der noch übrigen Montesquieuschen Triebfedern die edelste im einzelnen Menschen ist; so ist sie auch die, welche allein zum wahren Ziel führt. Nur der reine Enthusiasmus für die Konstitution – wenn Sie mir erlauben, so M.[c] vertu zu übersezen – blüht immer in ungeschwächter Kraft und nur er vergißt nie seiner Schranken. Aber die Hofnung, dieser Triebfeder so leicht Meister zu werden, schwächt schon die warnende und belehrende Erfahrung, daß man ihn nur in den blühendsten Zeiten der alten Staaten, und bei uns nur in isolirten, oder noch unkultivirten Ländern findet. Für eine bloße Idee haben sich wohl Philosophen, aber nie Nationen erwärmt. Bei diesen entsteht Begeisterung für die Konstitution nur dann, wenn diese Konstitution aus ihrem Nationalcharakter gleichsam hervorgeht, wenn sie aufhören müßten die Menschen zu sein, die sie sind, wenn sie die Konstitution verlören. Dann entsteht sie nicht leicht anders als in einer Epoche, in welcher die Bedürfnisse der Menschen noch sehr einfach, und die Nothwendigkeit ihrer Verbindung sehr groß ist. Die Festigkeit einer Vereinigung Mehrerer steht allemal im umgekehrten Verhältniß zu der Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse, und dem Gefühle der Kraft der Einzelnen. Diese Schwierigkeiten sahen die Alten wohl ein. Daher allein stammten Lykurgus gemeinschaftliche Mahlzeiten, daher Platos Weibergemeinschaft, Verbannung vieler Gattungen der Dichtkunst u.s.f. Daher sogar Aristoteles grausamer Vorschlag, bei einer zu großen Bevölkerung die Geburten zu unterdrükken. Wie man über diese Projekte und Geseze urtheilen mag, so sahen diese zu oft verlachten, und zu selten verstandenen Weisen wohl ein, daß, sobald der Mensch ein doppeltes Dasein kennt, das Dasein des Menschen und das des Bürgers, der Staat aufgelöst sei, den nur Bürgertugend erhalten soll. In eben dem Verstande hatte auch, was immer der furchtsam fromme M.[d] einwenden mag, Bayle recht zu behaupten, daß ein Staat von Christen nicht bestehen könne. Denn unstreitig ist eine der heilsamsten Folgen des Christenthums die größere Vereinigung der Menschen gewesen; und unläugbar trennen sich die Bande einer Gesellschaft in eben dem Grade, in welchem ihre Mitglieder sich andern, nicht zu ihnen gehörenden nähern. Alle alten Staaten, wenigstens gewisse Perioden hindurch, sind gleichsam einzelne kolossalische Menschengestalten. In jeder ein entschiedener Charakter, entschiedene Tugenden, entschiedene Fehler. Ueberall ist Einheit und wenn man mit andren vergleicht, überall unverkennbare Verschiedenheiten. Mit der Kultur, mit der größeren Gemeinschaft der Menschen, unter der Bildung einer gemeinschaftlichen Religion, und einer, nur in viele freilich oft weit abweichende Dialekte getheilten Sprache, muß das aufhören, und kann nicht zurük-kehren. Es ist eine Erscheinung, die, einst wohlthätig, einer zum mindesten gleich wohlthätigen gewichen ist. Die nüchterne Weisheit belehrt sich an ihren Schatten, aber versucht, nicht, sie, gleich einem abgeschiedenen Geiste, zurükzuzaubern.
Außer diesen M.[e] principes giebt es noch ein oft und, weise angewandt, immer mit Glück versuchtes Mittel, die Staatsverfassung zu sichern, die Gegeneinanderstellung mehrerer, von einander unabhängiger Mächte. Dieß muß man mehr als irgendwo in dem römischen Staate studiren. Ueberhaupt kann ich mich nicht enthalten, es zu sagen, daß die Römische Geschichte das einzige wahre Lehrbuch der Politik ist, und mir ewig der der größeste Politiker bleiben wird, der dieß unablässig studirt hat. In Rom giebt kein vernünftlender, oder schwärmerischer Gesezgeber eine neue Konstitution, aber man sieht ein Volk, das, ohne vorher eine Nation ausgemacht zu haben, nur durch seine Verfassung gebildet ist, ein Volk, das ewig mit seinen Nachbarn und dem Schiksale kämpft, und, bei seiner unbegränzten Freiheitsliebe, daher ewig in dem Fall ist eines Herrschers zu bedürfen, und einen Unterdrükker zu fürchten, dessen wahrhaft praktischer Verstand allemal, durch die Gefahr begeistert, das beste Heilmittel findet, und dessen edler, und selbst in seinen Fehlern großer Charakter nie seine Würde vergißt. Man hat den Livius verlacht, wenn er irgendeinmal sagt, die Römer hätten nie einen Krieg aus Eroberungssucht angefangen. Aber wenn sie Eroberungssucht besassen; so wars doch die edelste aller, und gewiß wären sie lieber die Schiedsrichter, als die Beherrscher der Nationen gewesen. Verzeihen Sie diese Ausschweifung, theurer Freund. Ich komme zurük. Die Römer wogen aufs genaueste die Gränzen der Macht gegeneinander ab. Sobald Ein Plebejer einen Kurulischen Stuhl einnahm, erschienen auf dem Marktplaz drei andre patrizische, ein Verhältniß, das, wer die Römische Verfassung wahrhaft studirt hat, nicht übertrieben finden wird. Dieß Mittel des Gleichgewichts – wenn ich so sagen darf – ist nur für alte Zeiten und alte Nationen. In jeder lassen sich verschiedne Stände, mit wohl abgewogener Macht, und mit gehörig gereizten Begierden einander entgegenstellen.
Welches von diesen Mitteln hat nun die konstituirende NV.[f] gewählt? Wenn mich nicht alle meine Sachkenntniß trügt, keins. Nichts steht der jedesmaligen Legislatur entgegen. Der König und seine Minister sind ohne Macht. Die Römischen Tribunen waren es auch. Auch sacrosancti wie der Französische König und[g] nur mit einem veto versehen. Aber das veto der Tribunen unterstüzte das Volk. Wehe dem Zeitpunkt, wo je das Volk seis gegen die Legislatur oder gegen den König handelt. In jedem Fall ists ein Eingriff in die Konstitution, und in die Verfassung sind nun beide Mächte gesezt, daß sie auf das Mittel reduzirt werden, eine dritte ungesezmäßige zu Hülfe zu rufen. Aber eine solche Gegeneinanderstellung der Stände hat die NV. auch nicht einführen wollen. Sie fürchtete nur den König, und dem hat sie Fesseln angelegt. Für die Legislatur und die Nation bürgt ihr Enthusiasmus für die neu eingeführte Freiheit. Der Grundsaz, auf dem die ganze Konstitution aufgeführt ist, ist Gleichheit, aber – gewiß zum erstenmal in irgendeiner Nation – Gleichheit nicht der Bürger, sondern der Menschen. Es mag immerhin eine schwere Sache sein, zu bestimmen, ob die Rechte der Menschheit einem Gesezgeber diesen Grundsaz abnöthigen. Auf der einen Seite, dünkt mich, erfordern die Menschenrechte wohl, daß jeder frei sei, aber schlechterdings nicht, daß jeder herrsche; auf der andren indeß halte ich es gleichfalls unrichtig, sich auf alte Verträge und Rechte zu beziehen. Das Recht da anführen, wo die Sache ganz geändert ist, heißt offenbar um der Form willen die Sache vernichten. Allein die nähere Ausführung und die Anwendung beider Bemerkungen erregt noch eine Menge von Schwierigkeiten. Indeß kommt es auch hier auf diese Erörterung nicht an. Neben dem Grundsaz der allgemeinen Menschengleichheit wäre es immer Pflicht der NV. gewesen ihrer Verfassung eine Triebfeder beizugeben, welche ihr die Dauer gesichert hätte, und die Möglichkeit leidet keinen Zweifel. Daß das Prinzip der Menschengleichheit selbst keine solche ist, davon, mein Theurer, ersparen Sie mir gewiß den Beweis. Wo nicht so verweise ich Sie auf den Saz, daß alle Energie mit der Ausbreitung hinschwindet, auf meinen vorigen Brief überhaupt, und auf die Erfahrung, welche das Geschrei über die Freierklärung der Negersklaven unter Menschen giebt, die einem Könige kaum noch den Titel Majestät einräumen.
Ich darf es daher, denke ich, sagen, es fehlt der Französischen Konstitution an allen Triebfedern, dem Könige an aller Macht, der Legislatur an allem Zaum, und der Nation an allem Zunder des Enthusiasmus. Nur Ein Staat, in der mir bekannten Geschichte, hat sich – die übrigen ungeheuren Verschiedenheiten abgerechnet – ohngefehr in gleicher Lage befunden, Athen. Das wollüstige Athenische Volk hatte gewiß keine Tugend, in der ausgelassensten Demokratie war nicht an Ehre, im monarchischen Verstande, zu denken, Furcht traf nur die Guten und Edlen, und die Macht des Volks hatte keine Zügel, als seine eigne durch Geschwäz bestechbare Eitelkeit. Dennoch hat Athen geblüht, und seit den Pisistratiden keine einheimische Tyrannie in seinen Mauren entstehen sehen. Denn die 30 Tyrannen gab bekanntermaaßen Lacedämon. Allein die Fehler der Athenischen Verfassung zeigt auch ihre Geschichte genug, und daß die Verfassung sich erhielt, war warlich nur Folge des Uebermaaßes der Demokratie, der mehr eiteln, als großen Freiheitsliebe des Volks, des Ostracismus und seiner übrigen Ungerechtigkeiten; lauter Heilmittel, welche warlich das Uebel selbst nicht sehr fürchterlich machen. Vielleicht möchten die Schriftsteller des Jahrhunderts Ludwigs XIV. mit ungünstiger Vorbedeutung so oft an die Aehnlichkeit von Paris und Athen erinnert haben.
Unausführbarer also, als jedes mir bisher bekannte Projekt, unausführbarer selbst als Platos Republik wird mir ewig die Französische Konstitution scheinen. Mag es immerhin unmöglich sein, in Platos Allegorie zu reden[h], das irdische, erdgebohrne Roß zu dem Wohnsiz der Urgestalten der Wesen über den Gestirnen zu lenken, näher scheint mir dem Ziele doch der, welcher kühn wagt, ihm mit Gebiß und Geißel zu gebieten, als der, welcher ihm ohnmächtig den Zügel überläßt.
2., Ich gehe zum zweiten nun über, welchen[i] Zwek muß die wahre Politik jeder Staatsverfassung vorschreiben, und welches sind daher die Schranken ihrer Wirksamkeit?. |sic| Sie werden es mir verzeihen, wenn ich hiebei noch weniger Rüksicht auf Frankreich nehme. Die Ideen sind mir an sich interessanter, und über Frankreichs jezige Verfassung fehlen mir viele Data.
Das physische und moralische Wohl der Nation, sagen fast alle unsre politischen Schriftsteller, ist der Zwek des Staats, und Religions und Polizeiedikte sagen es deutlich genug, daß die Ausführung hier der Theorie sehr nahebleibt. Vorzüglich häufig aber ist das Einmischen des Staats in die Betreibung aller Gewerbe. Akkerbau, Handwerker, Handel, Künste und Wissen-schaften selbst, alles erhält Leben und Lenkung vom Staat. Auf diesen Grundsäzen ist die seit einiger Zeit so gepriesene Polizeiwissenschaft erbaut, und vielen Schriftstellern nach, sollte man glauben, das einzige Verderben sei nur dieß, daß man nicht jeden einzelnen Unterthan, überall, und, wie Rousseau seinen Emil, bis ins Ehbett hinein hofmeistern kann. Die Alten schränkten auch die Freiheit auf mancherlei Art ein, oft auf eine drükkendere. Aber der Unterschied ist und bleibt mächtig. Die Alten sorgten für die Kraft und Bildung des Menschen, als Menschen; die Neueren für seinen Besiz und seine Erwerbfähigkeit. Die Alten suchten Tugend, die Menschen[j] Glückseligkeit. Ein Philosoph (Sie werden den Rakker hier nicht erkennen, es ist Tiedemann) entblödet sich nicht zu sagen, daß, wenn den Gerechten alles Unglük immer nothwendig träfe, was Plato einmal in seiner Republik schildert, die Ungerechtigkeit Pflicht sein werde[k]; der selbst, welcher die Moralität in ihrer höchsten Reinheit sah und darstellte, glaubt durch ungeheuer künstliche Maschinerie seinem Ideal des Menschen die Glükseligkeit warlich mehr wie eine fremde Belohnung, als wie ein eigen errungenes Gut zuzuführen. Ich verliere kein Wort über diese Verschiedenheit. Ich schließe nur mit einer Stelle aus Aristoteles Ethik: Το οικειον ἑκαστῳ τῃ φυσει, κρατιστον καὶ ἡδιστον εσθ’ ἑκαστῳ καὶ ανθρωπῳ δη ὁ κατα τον νουν βιος, ειπερ μαλιστα τουτο τῳ ανθρωπος, οὑτος αρα και ευδαιμονεστατος.[l]
So allgemein indeß auch jenes angeführte Prinzip ist, so verdient es, dünkt mich, doch noch allerdings einer nähern Prüfung. Der wahre Zwek des Menschen – nicht der, den die wechselnde Neigung, sondern den die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt – ist die höchste und proportionirlichste Bildung seiner Kräfte zu Einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit nicht bloß die erste, sondern die einzige Bedingung. Allein außer der Freiheit erfordert die menschliche Bildung noch etwas anders, das man aber freilich, als jedesmalige Folge der Freiheit mit in ihr antrift. Dieß ist Mannigfaltigkeit der Situationen. Auch der freiste und unabhängigste Mensch, in einförmige Lagen gesezt, bildet sich minder aus. Freilich giebt es nun auch eine Art der Unterdrükkung, die, statt den Menschen einzuschränken, den Dingen um ihn her eine beliebige Gestalt giebt, allein besser ists immer, diese beiden Dinge – so sehr sie auch gewissermaaßen Eins und dasselbe sind – noch von einander zu trennen.
Alles reduzirt sich im Menschen auf Form und Materie. Die reinste Form mit der leichtesten Hülle nennen wir Idee, die am wenigsten mit Gestalt begabte Materie sinnliche Empfindung. Aus der Verbindung der Materie geht die Form hervor. Je größer die Fülle und Mannigfaltigkeit der Materie, je erhabner die Form. Ein Götterkind ist nur die Frucht unsterblicher Eltern. Die Form wird wiederum gleichsam Materie einer noch schönern Form. So wird die Blüthe zur Frucht, und aus dem Samenkorn der Frucht entspringt der neue, von neuem blüthenreiche Stamm. Je mehr die Mannigfaltigkeit zugleich mit der Feinheit der Materie zunimmt, desto höher die Kraft. Denn desto inniger deren Zusammenhang. Die Form scheint gleichsam in die Materie. die Materie in die Form verschmolzen, oder um ohne Bild zu reden, je ideenreicher die Gefühle des Menschen, und je gefühlvoller seine Ideen, desto unerreichbarer seine Erhabenheit. Denn auf diesem ewigen Begatten der Form und der Materie, oder des Mannigfaltigen mit der Einheit beruht die Verschmelzung der beiden im Menschen vereinten Naturen, und auf dieser seine Größe. Aber die Stärke der Begattung hängt von der Stärke der Begattenden ab. Der höchste Moment des Menschen ist dieser Moment der Blüthe. Die minder reizende, einfache Gestalt der Frucht weist gleichsam selbst auf die Schönheit der Blüthe hin, die sich durch sie entfalten wird. Auch eilt nun alles zur Blüthe hin. Was zuerst dem Samenkorn entsprießt, ist noch fern von ihrem Reiz. Der volle dikke Stengel, die breiten auseinander fallenden Blätter bedürfen noch einer mehr vollendeten Bildung. Stufenweise steigt diese, wie das Auge sich am Stamm erhebt; zartere Blätter sehnen sich gleichsam sich zu vereinigen, und schließen sich enger und enger, bis gleichsam der Kelch das Verlangen stillt. Indeß ist das Geschlecht der Pflanzen nicht von dem Schiksal gesegnet. Die Blüthe fällt ab, und die Frucht bringt wieder den gleich rohen und gleich sich verfeinernden Stamm hervor. Wenn im Menschen die Blüthe welkt, so macht sie nur einer schönern Plaz, und den Zauber der schönsten verbirgt unsrem Auge die ewig unerforschbare Unendlichkeit. Was der Mensch nun von außen empfängt, ist nur Samenkorn. Seine energische Thätigkeit muß es, seis auch das schönste, erst auch zum segenvollsten für ihn machen. Aber wohlthätiger ists ihm immer in dem Grade, in dem es kraftvoll und – so sehr auch dieß Eins ist – eigen in sich ist. Das höchste Ideal des Zusammenexistirens menschlicher Wesen wäre mir das, in dem jedes nur aus sich selbst und um seiner selbst sich entwikkelt. Physische und moralische Natur würden diese Menschen schon nah an einander führen, und wie die Kämpfe des Krieges ehrenvoller sind, als die der arena , wie die Kämpfe erbitterter Bürger höhern Ruhm gewähren als die getriebner Miethssoldaten; so würde auch das Ringen der Kräfte dieser Menschen die höchste Energie zu gleich beweisen und erzeugen.
Gestehn Sie es mir, ist es nicht eben das, was uns an die Zeitalter Griechenlands und Roms, und jedes Zeitalter allgemein an ein entferntes hingeschwundnes so namenlos fesselt? Ist es nicht vorzüglich, daß diese Menschen härtere Kämpfe mit dem Schiksal, härtere mit Menschen zu bestehn hatten? daß die größere ursprüngliche Kraft, und Eigenthümlichkeit einander begegnete, und neue wunderbare Gestalten schuf? Jedes folgende Zeitalter – und in wieviel schnellern Graden muß dieß Verhältniß von jezt an steigen – muß den vorigen an Mannigfaltigkeit nachstehen, an Mannigfaltigkeit der Natur, die ungeheuren Wälder sind ausgehauen, die Moräste getroknet u.s.f., der Menschen durch die immer größere Mittheilung und Vereinigung, der menschlichen Werke durch die beiden vorigen Gründe. Dieß ist einer der vorzüglichsten Gründe, welcher die Idee des Neuen, des Ungewöhnlichen, des Wunderbaren so viel seltner, das Staunen, Erschrekken beinahe zum Schemen, und die Erfindung neuer, noch unbekannter Hülfsmittel so selten nothwendig macht. Dagegen ist es unläugbar, daß, wenn die physische Mannigfaltigkeit geringer wurde, eine weit befriedigendere intellektuelle und moralische an ihre Stelle trat, und daß unser mehr verfeinter Geist, und unser wenn auch gleich stark gebildeter, doch reizbarer kultivirter Verstand Gradationen und Verschiedenheiten bemerkt, und in das praktische Leben überträgt, die auch vielleicht den Weisen des Alterthums, oder doch wenigstens nur ihnen nicht entzogen sein würden. Es ist im ganzen Menschengeschlecht, wie im einzelnen Menschen gegangen. Das Gröbere ist abgefallen, das Feinere ist geblieben. Und so wäre es ohne allen Zweifel segenvoll, wenn das Menschengeschlecht Ein Mensch wäre, oder die Kraft eines Zeitalters eben so als ihre |sic|[m] Bücher oder Erfindungen auf das folgende übergienge. Allein das ist bei weitem der Fall nicht. Freilich besizt nun auch unsre Verfeinerung eine Kraft, und die vielleicht jene gerade um den Grad ihrer Feinheit an Stärke übertrift; aber es fragt sich ob nicht die frühere Bildung durch das Gröbere immer vorangehen muß? Ueberall keimt doch das Geistige erst aus dem Sinnlichen. Und – wenn es auch nicht hier der Ort ist, auch nur den Versuch dieser Erörterung zu wagen – so folgt doch gewiß soviel aus dem Vorigen, daß man wenigstens die Kraft, und die Nahrungsmittel, die wir besizen, sorgfältigst bewahren müsse.
Bewiesen halte ich demnach durch das Vorige, daß die wahre Vernunft den Menschen keinen andren Zustand als einen solchen wünschen kann, in welchem nicht nur jeder Mensch die ungebundenste Freiheit hat, sich aus sich selbst zu entwikkeln, sondern in dem auch die physische Natur keine andre Gestalt von Menschenhänden empfängt, als ihr jeder Mensch, nach dem Maaß seines Bedürfnisses und seiner Neigung, nur beschränkt durch seine Kraft und sein Recht, selbst giebt. Von diesem Grundsaz darf meines Erachtens die Vernunft nie mehr nachgeben, als nur soviel zu seiner Erhaltung selbst nothwendig ist. Er müßte daher auch jeder Politik und besonders. der Beantwortung der Frage, von der ich hier rede, immer zum Grunde liegen. Ich habe gesucht, ihn aus den höchsten Gesichtspunkten zu betrachten. Wenn das die Unbequemlichkeit hat, daß man dadurch die Wahrheiten von der Anwendung weiter entfernt, so hat es auch den Nuzen, daß ihre Richtigkeit evidenter ist, daß sie dem ganzen Gewebe der Säze des Aufstellenden oder des Prüfenden inniger einverleibt werden, und daß selbst die Entfernung von aller Anwendung gewisser eine unschikliche Anwendung verhindert.
Der Zwek einer Staatsverfassung kann positiv und negativ sein. Er kann Glük befördern oder nur Uebel verhindern wollen, und im leztern Fall Uebel der Natur oder Uebel der Menschen. Schränkt er sich auf das leztere ein, so sucht er nur Sicherheit und dieser Sicherheit lassen Sie mich einmal alle übrigen möglichen Zwekke vereint entgegensezen.
Die eben festgestellten Grundsäze verwerfen nun schon an sich jedes Bemühen des Staats, seine Sorgfalt an die Stelle der Sorgfalt der Nation wenigstens in allen Dingen zu sezen, die nicht unmittelbaren Bezug auf die Kränkung der Rechte des Einen durch den andren haben; und ich könnte mich insofern dabei begnügen. Indeß wird es doch sogar nothwendig sein, hier noch ein wenig mehr ins Détail zu gehen.
Der Staat sieht das Land und die Nation, als ein Ganzes an, und glaubt für die Erhaltung dieses Ganzen in seinem moralischen und physischen Wohlstande sorgen zu müssen. Daher die Beförderung des Akkerbaues, der Industrie und des Handels durch Geseze und Ermunterungen, daher, oder wenigstens oft daher alle Finanz und Münzoperationen, Ein und Ausfuhrverbote u.s.f. Denn ich bleibe mit Fleiß bei dem physischen Wohl hier stehn. Daher noch ferner alle Veranstaltungen zur Verhütung oder Herstellung von Beschädigungen durch die Natur, ferner alle Armenanstalten, kurz jede Einrichtung des Staats, welche das physische Wohl der Nation zu erhalten, oder zu befördern die Absicht hat. Alle diese, behaupte ich nun, sind schädlich, und einer wahren, von den höchsten, aber immer menschlichen Gesichtspunkten ausgehenden Politik unangemessen.
Der Geist der Regierung herrscht in einer jeden solchen Einrichtung, und wie weise und heilsam auch dieser Geist sei; so bringt er Einförmigkeit, und eine fremde Handlungsweise in der Nation hervor. Statt daß die Menschen in Gesellschaft treten, um ihre Kräfte zu schärfen, sollten sie auch dadurch an ausschließendem Besiz und Genuß verlieren, so erlangen sie Güter auf Kosten ihrer Kraft. Gerade die aus der Vereinigung Mehrerer entstehende Mannigfaltigkeit ist das höchste Gut, das die Gesellschaft giebt, und diese Mannigfaltigkeit geht doch gewiß immer in dem Grade der Einmischung des Staats verloren. Es sind nicht mehr eigentlich die Mitglieder einer Nation, die mit sich in Gemeinschaft leben, sondern einzelne Unterthanen, die mit dem Staat, d. h. dem Geist, der in seiner Regierung herrscht, in Verhältniß kommen, und zwar in ein Verhältniß, in welchem schon die Macht des Staats das freie Spiel der Kräfte aufhebt. Gleichförmige Ursachen haben gleichförmige Wirkungen. Je mehr also der Staat mitwirkt, desto ähnlicher ist nicht bloß alles Wirkende, sondern auch alles Gewirkte. Dieß ist auch gerade die Absicht der Staaten. Sie wollen Wohlstand und Ruhe. Beide aber erhält man immer in eben dem Grade, in dem das Einzelne weniger mit einander streitet. Allein was der Mensch beabsichtet und beabsichten muß, ist ganz etwas anders, es ist Mannigfaltigkeit und Thätigkeit. Nur das giebt vielseitige und kraftvolle Charaktere, und gewiß ist noch kein Mensch tief genug gesunken, um in sich für sich Wohlstand und Glük der Größe vorzuziehen. Wer aber für andre so raisonnirt, den hat man mit Grunde in Verdacht, daß er die Menschheit miskennt und aus Menschen Maschinen machen will.
Das wäre also die zweite schädliche Folge, daß diese Einrichtungen des Staats die Kraft der Nation schwächen. So wie durch die Form, die aus der selbstthätigen Materie hervorgeht, die Materie selbst mehr Fülle und Schönheit erhält. Denn was ist sie anders als die Verbindung dessen was erst stritt? eine Verbindung, zu der allemal die Auffindung neuer Vereinigungspunkte, folglich gleichsam eine Menge neuer Entdekkungen nöthig ist, die immer im Verhältniß mit der größern vorherigen Verschiedenheit steigt. Eben so wird die Materie vernichtet durch diejenige, die man ihr von außen giebt. Denn das Nichts unterdrükt da das Etwas. Alles im Menschen ist Organisation. Was in ihm gedeihen soll, muß in ihm gesäet werden. Alle Kraft sezt Enthusiasmus, und dieser allemal die Bedingung voraus, daß man den Gegenstand desselben als sein Eigenthum ansieht. Nun aber hält der, von seinen ersten Kräften nie ganz entartende Mensch das nie so sehr für sein, was er besizt, als was er thut, und der Arbeiter, der einen Garten bestellt, ist gewiß in einem wahreren Sinn Eigenthümer, als der Bettler, dem ein König eine halbe Provinz gäbe. Was würde man sagen, wenn ein Fürst nach Platos Vorschlage[n] Jungfrauen und Jünglinge ausläse, und nach seinen Principien vermählte? In den Extremen erschrekken wir vor den Dingen, aber die Elemente der Extreme übersehen wir, und wenn wir mit geringerem Irrthum den Schaden nicht achten, der von ihnen zu besorgen steht; so vergessen wir doch mit größerem die heilsamen Folgen, die aus ihnen zu ziehen wären. Mit hinreichender Sorgfalt – deren Versuche aber freilich alsdann am besten gelängen, wenn sie am müßigsten wären – ließen sich vielleicht aus allen Bauren und Handwerkern Künstler bilden, d.h. Menschen, welche ihr Gewerbe um ihres Gewerbes willen liebten, durch eigne Erfindsamkeit und eigengelenkte Kraft übten, und dadurch ihren Kopf, ihren Charakter, ihren Genuss erhöhten; und so würde die Menschheit durch eben die Dinge geadelt, die jezt so oft, wie schön sie auch an sich sind, nur dazu dienen, sie zu entehren. Sich selbst in allem Thun und Treiben überlassen, von jeder fremden Hülfe entblößt, die sie nicht selbst sich verschaften, würden die Menschen auch oft mit und ohne Schuld in Verlegenheit und Unglük gerathen. Aber das Glük, zu dem der Mensch bestimmt ist, ist auch kein andres, als das seine Kraft ihm verschaft. Und diese Lagen gerade sind es, welche den Verstand schärfen und den Charakter bilden. Wo der Staat die Selbstthätigkeit durch zu spezielles Einwirken verhindert, da – entstehen solche Uebel nicht? O! das wäre warlich ein unbedeutender Nachtheil, und der Anblik der genuß vollen Heiterkeit würde bald die Stirn auch des strengsten Stoikers entfalten. Aber sie entstehen auch da, und überlassen den einmal auf fremde Kraft zu lehnen gewohnten Menschen nun einem trostlosen Schiksal. Denn so wie das Ringen und thätige Arbeit das Unglük erleichtert, so und im zehnfach höhern Grade erschwert es hofnungslose, vielleicht getäuschte Erwartung. Selbst den besten Fall angenommen, gleichen die Staaten, von denen ich hier rede, nur zu oft den Aerzten, die die Krankheit nähren und den Tod entfernen. Ehe es Aerzte gab, kannte man nur Gesundheit oder Tod.
Eine fernere nachtheilige Folge dieser Art von Staatssystem rührt aus den Veranstaltungen her, die erfordert werden, um es in Ausübung[o] zu bringen. Die Geschäfte des Staats erhalten dadurch eine Verflechtung, die, um nicht Verwirrung zu werden, einer unglaublichen Menge detaillirter Einrichtungen und Hände bedarf. Von diesen haben indeß doch die meisten gleichsam nur mit Zeichen und Formeln der Dinge zu thun. Möchte es hingehen, daß dadurch viele vielleicht trefliche Köpfe dem Denken, viele sonst nüzlicher beschäftigte Hände der reellen Arbeit entzogen werden, eben da diese Beschäftigungen, wie auch immer ihre Beschaffenheit sein mag, eine große Wichtigkeit erhalten, und allerdings, um konsequent zu sein, erhalten müssen, so werden dadurch überhaupt die Gesichtspunkte des Wichtigen und Unwichtigen, des Ehrenvollen und Verächtlichen, des lezten und der untergeordneten Endzwekke verrükt. Und da das eben Angführte, die Nothwendigkeit von Beschäftigungen dieser Art, aus mancherlei leicht in die Augen fallenden Gründen ein so großer Nachtheil nicht ist; so gehe ich zu diesem lezten, der Verrükkung der Gesichtspunkte über.
Die Menschen werden um der Sachen, die Kräfte um der Resultate willen vernachlässigt. Ein Staat gleicht, nach diesem System, mehr einer aufgehäuften Menge von leblosen und lebendigen Werkzeugen[p] der Wirksamkeit und des Genusses, als einer Menge thätiger und genießender Kräfte. Bei der Vernachlässigung der Selbstthätigkeit der handelnden Wesen scheint nur auf Glükseligkeit und Genuß gearbeitet zu sein. Allein wenn da über Glükseligkeit und Genuß nur die Empfindung des Genießenden richtig urtheilt – die Berechnung richtig wäre; so wäre sie doch immer weit von der Würde der Menschheit entfernt. Denn woher käme es sonst, daß eben dieses System auf den menschlich höchsten Genuß gleichsam aus Besorgniß vor seinem Gegentheil Verzicht thut? Der Mensch genießt am meisten in dem Moment, in welchem er sich in dem höchsten Grade seiner Kraft und seiner Einheit fühlt. Freilich ist er auch dann dem höchsten Elende nah. Denn auf den Moment der Spannung vermag nur eine gleiche Spannung zu folgen, und die Richtung – zum Genuß oder zum Entbehren – liegt in der Hand des unbesiegten Schiksals. Aber wenn das Gefühl des Höchsten im Menschen nur Glük zu heißen verdient, so gewinnt auch Schmerz und Leiden eine veränderte Gestalt. Der Mensch in seinem Innern wird der Siz des Glüks und des Unglüks, und er wechselt ja nicht mit der wallenden Flut, die ihn trägt. Jenes System führt, meiner Empfindung nach, auf ein fruchtloses Streben, dem Schmerz zu entrinnen. Wer sich wahrhaft auf Genuß versteht, erduldet den Schmerz, der doch den Flüchtigen ereilt, und freut sich der Stärke, die auch den Heftigsten unüberwunden läßt. Er freut sich unaufhörlich am ruhigen Gange des Schiksals, und der Anblik der Größe fesselt ihn süß, es mag entstehen, oder vernichtet werden. So kommt er selbst – doch freilich nur der Schwärmer in andren, als seltnen Momenten – zu dem Gefühl, daß auch der Moment des Gefühls der eignen Zerstörung ein Moment des Entzükkens ist.
Beschuldigen Sie mich nicht, lieber Freund, diese Nachtheile übertrieben zu haben. Ich mußte die volle Wirkung dieses Einmischens des Staats schildern, aber es versteht sich von selbst, daß sie, nach dem Grade und nach der Art des Einmischens selbst, sehr verschieden modifizirt sind. Überhaupt bitt’ ich Sie, bei allem, was dieser Brief Allgemeines enthält, von Vergleichungen mit der Wirklichkeit gänzlich zu abstrahiren. In dieser findet man selten einen Fall voll und rein, und selbst dann sieht man nicht abgeschnitten und für sich die einzelnen Wirkungen einzelner Dinge. Dann vergessen Sie nicht, daß, wenn einmal schädliche Einflüsse vorhanden sind, das Verderben mit sehr beschleunigten Schritten weiter eilt. Wie aus größerer Kraft, mit größerer vereint, doppelt größere entsteht, so artet geringere mit geringerer in doppelt geringere aus. Welcher Gedanke selbst wagt es der Schnelligkeit dieser Fortschritte zu folgen[q]? Sogar auch zugegeben, die Nachtheile wären minder groß, so, glaube ich, bestätigt sich meine Theorie doch noch bei weitem mehr durch den warlich namenlosen Segen, der aus ihrer Befolgung – wenn diese je ganz möglich wäre, wie ich selbst am meisten zweifle – entstehen müßte.
Ich könnte hier ein erfreuliches Gegenbild eines Volkes anstellen |sic|[r], das in der höchsten und ungebundensten Freiheit, und in der größesten Mannigfaltigkeit seiner eignen und der übrigen Verhältnisse um sich her existirte, ich könnte zeigen, wie hier noch in eben dem Grade schönere, höhere und wunderbarere Gestalten der Originalität und der Mannigfaltigkeit[s] erscheinen müßten, als in dem schon so unnennbar reizenden Alterthum, in welchem die Mannigfaltigkeit eines unkultivirten Volks allemal roher und gröber ist, in welchem mit der Freiheit auch allemal die Stärke und selbst der Reichthum der Sitten wächst, und in welchem, bei der fast gränzenlosen Verbindung aller Nationen und Welttheile mit einander, schon die Elemente gleichsam zahlreicher sind; zeigen, welche Stärke hervorblühen müßte, wenn jedes Wesen sich aus sich selbst organisirte, wenn es, ewig von den schönsten Gestalten umgeben, mit uneingeschränkter und ewig durch die Freiheit ermunterter Selbstthätigkeit diese Gestalten in sich verwandelte; zeigen, wie in diesem Volke keine Kraft und keine Hand für die Erhöhung und den Genuß des Menschendaseins verloren gienge, und endlich, wie schon dadurch ebenso auch die Gesichtspunkte aller nur dahin gerichtet, und von jedem andren falschen oder doch weniger der Menschheit würdigen Endzwek abgewandt werden würden. Ich könnte dann damit schließen, Sie aufmerksam darauf zu machen, wie diese wohlthätigen Folgen einer solchen Konstitution, unter einem Volke, welches es sei, ausgestreut, selbst dem freilich nie ganz tilgbaren Elende der Menschen, den Verheerungen der Natur, dem Verderben der feindseligen, Neigungen der Menschen und den Ausschweifungen einer zu üppigen Genussesfülle, einen unendlich großen Theil seiner Schreklichkeit nehmen würden. Allein ich begnüge mich das Gegenbild gezeigt zu haben. Es ist mir genug Ideen hinzuwerfen, damit Ihr reiferes Urtheil sie prüfe.
Der erste Grundsaz dieses Theils meiner Politik wäre daher: der Staat gehe keinen Schritt weiter, als zur Sicherstellung der Bürger gegen sie selbst und gegen auswärtige Feinde nothwendig ist, zu keinem andren Zwekke beschränke er ihre Freiheit. Die nähere Anwendung übergehe ich. Ich bemerke nur, daß diese Beschränkungen auf mancherlei Weise geschehen; durch Geseze, Ermunterungen, Preise, dadurch, daß der Landesherr selbst der beträchtlichste Eigenthümer ist, und daß er einzelnen Bürgern überwiegende Rechte, Monopolien u.s.w. einräumt. Wenn man hier gegen das erste und lezte keinen Einwurf erregt, so scheint es doch sonderbar, dem Staat wehren zu wollen, was jeder Einzelne darf, Belohnungen aussezen, unterstüzen, Eigenthümer sein. Wäre es in der Ausübung möglich, daß der Staat eben so eine zwiefache Person ausmachte, als er es in der Abstraktion thut; so wäre hiegegen nichts zu erinnern. Es wäre dann nicht anders, als wenn eine Privatperson einen mächtigen Einfluß erhielte. Allein da, jenen Unterschied zwischen Praxis und Theorie nach abgerechnet, der Einfluß einer Privatperson durch Konkurrenz andrer, Versplitterung ihres Vermögens, selbst durch ihren Tod aufhören kann, lauter Dinge, die beim Staat nicht zutreffen; so steht noch immer der Grundsaz entgegen, daß der Staat sich in nichts mischen darf, als was die Sicherheit angeht. Auch handelt eine Privatperson aus andren Gründen als der Staat. Wie z.B. ein einzelner Bürger Prämien aussezt – die ich auch, wie es doch wohl nie ist, gleich wirksam mit denen des Staats annehmen will – so thut er das seines Vortheils halber. Sein Vortheil aber steht, wegen des ewigen Verkehrs mit allen übrigen Bürgern, und wegen der Gleichheit seiner Lage und der ihrigen, mit dem Vortheile oder Nachtheile andrer, folglich mit ihrem Zustande, in genauem Verhältniß. Der Zwek, den er erreichen will, ist schon gewissermaaßen in der Gegenwart gegründet, und wirkt eben darum heilsam. Die Gründe des Staats hingegen sind Ideen und Grundsäze, bei denen auch die genaueste Berechnung oft täuscht, und sind es aus der Privatlage des Staats geschöpfte Gründe, so ist diese Lage der Lage der Bürger nie so gleich. Wäre sie dieß, nun so ists auch in der Wirklichkeit nicht der Staat mehr, der handelt, und die Natur dieses Raisonnements selbst verbietet dann seine Anwendung.
Eben dieß und das ganze vorige Raisonnement aber gieng allein aus Gesichtspunkten aus, welche bloß die Kraft des Menschen, als solche, seine innere Bildung zum Gegenstand hatten. Mit Recht würde man es der Einseitigkeit beschuldigen, wenn es die Resultate, deren Dasein so nothwendig ist, damit jene Kraft nur wirken kann, ganz vernachlässigte. Es entsteht also hier noch die Frage, ob eben diese Dinge, von denen ich die Sorge des Staats entferne, ohne ihn und für sich gedeihen können. Hier wäre es nun der Ort die einzelnen Arten der Gewerbe: Akkerbau, Industrie, Handel, und alles übrige, wovon ich hier zusammengenommen rede, einzeln durchzugehen, und mit Sachkenntniß auseinanderzusezen, welche Nachtheile und Vortheile Freiheit und Selbstüberlassung ihnen gewährt. Fürchten Sie Sich nicht, daß ich in diese Erörterung eingehen werde. Aufrichtig halte ich sie für unnöthig, weil die Wahrheit zu sehr am Tage liegt, allein gut und vorzüglich historisch ausgeführt, würde sie den sehr großen Nuzen gewähren, diese Ideen mehr zu empfehlen und zugleich die Möglichkeit einer sehr modifizirten Ausführung – da eine uneingeschränkte unstreitig Raserei sein würde – zu beurtheilen. Ich begnüge mich an einigen wenigen allgemeinen Bemerkungen. Jedes Geschäft – welcher Art es auch sei – wird besser betrieben, wenn man es um seiner selbst willen, als den Folgen zu Liebe treibt. Dieß liegt so sehr in der Natur des Menschen, daß gewöhnlich, was man anfangs nur des Nuzens wegen wählt, zulezt für sich Reiz gewinnt. Nun aber rührt dieß nur daher, weil dem Menschen Thätigkeit lieber ist als Besiz, aber Thätigkeit nur, insofern sie Selbstthätigkeit ist. Gerade der rüstigste Mensch würde dem Zwange Müssiggang vorziehen. Auch wächst die Idee des Eigenthums nur mit der Idee der Freiheit, und gerade die energischste Thätigkeit dankt man dem Gefühle des Eigenthums. Jede Erreichung eines großen Endzweks erfordert Einheit der Anordnung. Das ist gewiß. Eben so auch jede Verhütung oder Abwehrung großer Unglüksfälle, Hungersnoth, Ueberschwemmungen u.s.f. Allein diese Einheit der Anordnung läßt sich durch Nationalanstalten eben so gut und besser als durch Staatsanstalten hervorbringen. Einzelne Theile der Nation und sie selbst im Ganzen muß nur Freiheit haben, sich durch Verträge zu verbinden. Es bleibt immer ein unläugbar wichtiger Unterschied zwischen einer Nationalanstalt und einer Staatseinrichtung. Jene hat nur eine mittelbare, diese eine unmittelbare Gewalt. Bei jener ist daher mehr Freiheit im Eingehen, Trennen, und Modifiziren der Verbindung. Anfangs sind gewiß alle Staatsverbindungen nichts als solche Nationenvereine gewesen. Aber das ist eben der Verderb, wenn die Absicht, Sicherheit zu erhalten und andre Zwekke zu erreichen, mit einander verbunden wird. Wer dieses Geschäft besorgen soll, muß um der Sicherheit willen absolute Gewalt besizen. Diese aber dehnt er nun auch auf das Uebrige aus, und je mehr sich die Einrichtung von ihrer Entstehung entfernt, desto mehr wächst die Macht, und desto mehr verschwindet die Erinnerung des Grundvertrags. Eine Anstalt im Staat aber hat nur Gewalt, insofern sie diesen Vertrag und sein Andenken erhält. Schon dieser Grund allein könnte hinreichend scheinen. Allein dann entstehen auch Vereinigungen freier Menschen in einer Nation mit größerer Schwierigkeit. Wenn nun dieß auf der einen Seite auch der Erreichung der Endzwekke schadet – wo gegen doch immer zu bedenken ist, daß allgemein was schwerer entsteht, weil gleichsam die lang geprüfte Kraft sich in einander fugt, auch fester besteht – so ist doch gewiß überhaupt jede große Vereinigung minder heilsam. Je mehr der Mensch für sich wirkt, desto mehr bildet er sich. In einer großen Vereinigung wird er zu leicht Werkzeug. Auch sind diese Vereinigungen Schuld, daß oft das Zeichen an die Stelle der Sache tritt, was der Bildung allemal hinderlich ist. Die todte Hieroglyphe begeistert nicht wie das Symbol der Natur. Ich erinnere nur, statt alles Beispiels, an Armenanstalten. Tödtet etwas anders so sehr alles wahre Mitleid, alle hoffende, aber anspruchlose Bitte, alles Vertrauen des Menschen auf Menschen? Verachten Sie nicht mit mir den Bettler, dem es lieber wäre ein Jahr im Hospital bequem ernährt zu werden, als nach mancher erduldeten Noth nicht auf eine hinwerfende Hand, aber auf ein theilnehmendes Herz zu stoßen? Ich gebe es also zu, wir hätten diese Riesenfortschritte ohne die großen Massen nicht gemacht, in welchen das Menschengeschlecht, wenn ich so sagen darf, in den lezten Jahrhunderten gewirkt hat, allein nur die schnellen nicht. Die Frucht wäre langsamer aber dennoch gereift. Und sollte sie nicht segenvoller gewesen sein? Ich glaube daher von diesem Einwurf zurükkehren zu können. Zwei andre bleiben der Folge zur Prüfung aufbewahrt, nemlich, ob auch bei der Sorglosigkeit des Staats, die ich ihm hier vorschreibe, die Erhaltung der Sicherheit möglich ist, und ob nicht wenigstens die Verschaffung der Mittel, welche dem Staate nothwendig eingeräumt werden muß, ein verwikkelteres Eingreifen der Räder der Staatsmaschine in die Verhältnisse der Bürger nothwendig macht?
Wäre es mit dem Uebel, das die Zwietracht, die πλεονεξια der Menschen untereinander stiftet, wie mit den physischen Übeln der Natur, oder denjenigen moralischen – die ihnen wenigstens hierin gleich kommen – die durch Uebermaaß des Genusses oder des Entbehrens auf eigne Zerstörung hinauslaufen; so wäre gar keine Staatsvereinigung nöthig. Jenen würde der Muth, die Klugheit und Vorsicht der Menschen, diesen die durch Erfahrung belehrte Weisheit von selbst steuren, und mit dem gehobnen Uebel ist in beiden auch immer Ein Kampf geendigt. Allein bei der Uneinigkeit der Menschen entsteht Kampf aus Kampf. Die Beleidigung fordert Rache und die Rache ist eine neue Beleidigung. Hier muß man also auf eine Rache zurükkommen, die keine neue Rache erlaubt, und diese ist die Strafe des Staats; oder ein Streit auf eine Entscheidung, welche die lezte ist, die Entscheidung des Richters. Auch bedarf nichts so eines unterwerfenden Befehls, und eines unbedingten Gehorsams, als die Unternehmungen des Menschen gegen den Menschen, man mag an die Abtreibung eines auswärtigen Feindes, oder an Erhaltung der Sicherheit im Staate selbst denken. Dieß ist es also eigentlich, was den Zwek des Staats ausmacht, und die Geschichte bestätigt diese Behauptung so sehr, daß in allen frühern Nationen vorzüglich die Könige nichts anders waren als Anführer im Kriege, oder Richter im Frieden. Ich sage alle Könige. Denn, wenn Sie mir diese Abschweifung erlauben, so zeigt uns die Geschichte, wie sonderbar es auch scheint, gerade in der Epoche, wo dem Menschen, der, mit noch sehr wenigem Eigenthum versehen, nur persönliche Kraft kennt und schäzt, und in die ungestörteste Ausübung derselben den höchsten Genuß sezt, das Gefühl seiner Freiheit das theuerste ist, nichts als Könige und Monarchien. So alle Staatsverfassungen Asiens, so die ältesten Griechenlands, Italiens, und die freiheitsliebendsten Stämme, die Germanischen. Denkt man über die Gründe hievon nach; so wird man gleichsam von der Wahrheit überrascht, daß gerade die Wahl einer Monarchie ein Beweis der höchsten Freiheit der Wählenden ist. Der Gedanke eines Befehlshabers entsteht, wie eben gesagt, nur durch das Gefühl der Nothwendigkeit eines Anführers oder Schiedsrichters. Nun ist Ein Führer unstreitig das Einfachste und Zwekmäßigste. Die Besorgniß, daß der Eine aus einem Führer und Schiedsrichter ein Herrscher werden möchte, kennt der wahrhaft freie Mann, die Möglichkeit selbst ahndet er nicht, er traut keinem Menschen die Macht, seine Freiheit unterjochen zu können, und keinem Freien den Willen zu Herrscher zu sein – wie denn auch in der That der Herrschsüchtige, nicht empfänglich für die hohe Schönheit der Freiheit, die Sklaverei liebt, nur daß er nicht der Sklave sein will – und so ist, wie die Moral mit den Lastern, die Theologie mit der Kezerei, die Politik mit der Knechtschaft entstanden. Nur freilich führen unsre Monarchen nicht eine so honigsüße Sprache, als die Könige bei Homer und Hesiodus.
Von der Sicherheit gegen auswärtige Feinde brauchte ich – um zu meinem Vorhaben zurükzukehren – kaum ein Wort zu sagen, wenn es nicht die Klarheit der Hauptideen vermehrte, sie auf alle einzelne Gegenstände nach und nach anzuwenden. Ich komme hier auf etwas zurük, wovon wir schon einmal mit einander redeten. Der Krieg scheint mir eine der heilsamsten Erscheinungen zur Bildung des Menschengeschlechts, und ungern sehe ich ihn nach und nach immer mehr vom Schauplaz zurüktreten. Er ist das freilich furchtbare Extrem, wodurch jeder thätige Muth gegen Gefahr, Arbeit und Ungemach geprüft und gestählt wird, der sich nachher in so verschiedene Nüancen im Menschenleben modifizirt, und ohne den der ganzen Gestalt die Stärke und Mannigfaltigkeit fehlten, ohne welche Leichtigkeit Schwäche und Einheit Leere ist. Sie werden mir antworten, daß es neben dem Kriege andre Mittel dieser Art giebt, physische, gefahrvolle Beschäftigungen, und moralische von mancherlei Gattung, die den festen, unerschütterten Staatsmann im Kabinett, und den freimüthigen Denker in seiner einsamen Zelle treffen können. Allein ich kann mich von der Vorstellung nicht losreißen, daß wie alles Geistige nur eine feinere Blüthe des Körperlichen, so auch dieses es ist. Nun lebt zwar der Stamm, auf dem sie hervorsprießen kann, in der Vergangenheit. Allein das Andenken der Vergangenheit tritt immer weiter zurük, die Zahl derer, auf welche es wirkt, vermindert sich immer in der Nation, und selbst auf diese wird die Wirkung schwächer. Andren oft gleich gefahrvollen Beschäftigungen, Seefahrten, dem Bergbau u.s.f. fehlt, wenn gleich mehr und minder, die Idee der Größe und des Ruhms, die mit dem Kriege so eng verbunden ist. Und diese Idee ist in der That nicht schimärisch. Sie beruht auf einer Vorstellung von überwiegender Macht. Den Elementen sucht man mehr zu entrinnen, ihre Gewalt mehr auszudauren, als sie zu besiegen. Mit Göttern Soll sich nicht messen Irgend ein Mensch. Rettung ist nicht Sieg. Was das Schiksal wohlthätig schenkt, und menschlicher Muth oder menschliche Erfindsamkeit nur benuzt, ist nicht Frucht und Beweis der Obergewalt. Dazu denkt auch jeder im Kriege, auf seiner Seite das Recht zu haben, jeder eine Beleidigung zu rächen. Nun aber achtet der natürliche Mensch es höher, seine Ehre zu reinigen, als Bedarf fürs Leben zu sammlen. Sie werden es mir nicht zutrauen, den Tod eines gefallnen Kriegers schöner zu nennen, als den Tod eines kühnen Empedokles, oder, um vielleicht nicht genug geehrte Männer zu nennen, den Tod von Robert[t] und Pilatre de Rozier. Allein diese Beispiele sind selten, und wer weiß, ob ohne jene sie überhaupt nur wären? Auch habe ich für den Krieg die ungünstigste Lage gewählt. Nehmen Sie die Spartaner bei Thermopylä. Ich frage Sie, was so ein Beispiel auf eine Nation wirkt? Wohl weiß ichs, derselbe Muth, dieselbe Selbstverläugnung kann sich in jeder Situation des Lebens zeigen, und zeigt sich in jeder in ihm. Aber wollen Sie es dem sinnlichen Menschen verargen, wenn das lebendigste Symbol ihn auch am meisten hinreisst, und können Sie läugnen, daß Symbole dieser Art wenigstens in der größten Allgemeinheit wirken und wieder die lebendigste Energie hervorbringen? Und bei allem dem, lieber Freund, was ich je von Uebeln hörte, die schreklicher waren, als der Tod, ich sah noch keinen Menschen, der das Leben in üppiger Fülle genoß, und der, ohne Schwärmer zu sein, den Tod verachtete. Am wenigsten aber existirten diese Menschen im Alterthum, wo man die Sache noch höher als das Zeichen, die Gegenwart noch höher als die Zukunft schäzte. Was ich daher hier von Kriegern sage, gilt auch nur von solchen, die – nicht gebildet, wie jene, in Platos Republik[u] – die Dinge, Leben und Tod, nehmen für das, was sie sind, für Krieger, die, das Höchste im Auge, das Höchste aufs Spiel sezen. Alle Situationen, in welchen sich die Extreme gleichsam an einander knüpfen, sind die interessantesten und bildendsten. Wo ist dieß aber mehr der Fall als im Kriege, wo Neigung und Pflicht, und Pflicht des Menschen und Bürgers im ewigen Streit ist? Schon der Gesichtspunkt, aus dem allein ich den Krieg für heilsam und nothwendig halte, sagt Ihnen, wie, meiner Meinung nach, im Staat davon Gebrauch gemacht werden müßte. Dem Geist, den er erwekt, muß Freiheit gewährt werden, durch alle Mitglieder der Nation sich zu ergießen. Schon dieß spricht gegen die stehenden Armeen. Ueberdieß sind sie und die neuere Art des Krieges freilich weit von dem Ideale entfernt, das für die Bildung des Menschen das nüzlichste wäre. Auch müßte ich sehr unglüklich in Auseinandersezung meiner Ideen gewesen sein, wenn Sie glaubten, der Staat sollte, meiner Meinung nach, von Zeit zu Zeit Kriege anrichten. Er gebe Freiheit und dieselbe Freiheit genieße ein benachbarter Staat. Die Menschen sind in jedem Zeitalter Menschen, und verlieren nie ihre ursprünglichen Leidenschaften. Es wird Krieg von selbst entstehen, und entsteht er nicht, nun so ist man wenigstens gewiß, daß der Friede weder durch Gewalt erzwungen, noch durch künstliche Lähmung hervorgebracht ist, und dann wird der Friede der Nation freilich ein eben so wohlthätigeres Geschenk sein, als der friedliche Pflüger ein holderes Bild ist, als der blutige Krieger. Und gewiß ist es, denkt man sich ein Fortschreiten der Menschen über mehr als eine Generation hinaus, so müßten die folgenden Zeiträume immer die friedlicheren sein. Aber dann ist der Friede aus den innern Kräften der Wesen hervorgegangen, dann sind die Menschen und zwar die freien Menschen friedlich geworden. Jezt – das beweist Ein Jahr der Europäischen Geschichte – genießen wir die Früchte des Friedens, aber nicht die der Friedlichkeit. Die menschlichen Kräfte, unaufhörlich nach einer gleichsam unendlichen Wirksamkeit strebend, wenn sie einander begegnen, vereinen , oder bekämpfen sich. Welche Gestalt der Kampf annehme, ob die des Krieges, des Wetteifers, welche Sie sonst nuanciren wollen, hängt vorzüglich von ihrer Verfeinerung[v] her |sic|.[w] Wenn ich es daher wagen darf allein aus dem in diesem ganzen Briefe gewählten Gesichtspunkte die Skizze einer Staatsverfassung zu entwerfen, so müßte den Krieg und Frieden beschließen allemal die Nation. Im Kriege selbst müßte der Staat anführen, und der Krieger durch den unbedingtesten Gehorsam gebunden sein.
Einiger, als in diesem Punkt, in dem ich dennoch auch, was eigentlich zum Zusammenhang des ganzen Raisonnements dieses Briefes gehört, völlig gegen allen Einwurf gesichert halte, werden Sie mit mir über die Sorgfalt des Staats zur Erhaltung der innern Sicherheit sein. Schon ein oberflächliches Raisonnement und selbst eine sehr mangelhafte Erfahrung lehrt, daß diese Sorgfalt mehr oder minder weit ausgreifen kann, ihren Endzwek zu erreichen. Sie kann sich begnügen begangne Unordnungen beizulegen und zu bestrafen. Sie kann ihre Begehung an sich zu verhüten suchen, und sie kann endlich, zu diesem Endzwek, den Bürgern überhaupt, ihrem Charakter und ihrem Geist, eine Wendung zu ertheilen bemüht sein, die hiezu abzwekt. Auch gleichsam die Extension ist verschiedner Grade fähig. Es können bloß Beleidigungen der Rechte der Bürger oder unmittelbarer Rechte des Staats untersucht und gerügt werden, oder man kann, indem man den Bürger als ein Wesen ansieht, das dem Staat die Anwendung seiner Kräfte schuldig ist, auch auf Handlungen ein wachsames Auge haben, deren Folgen sich nur auf die Handlenden selbst erstrekken. Alles dieß fasse ich hier auf einmal zusammen, und rede daher allgemein von allen Einrichtungen des Staats, welche zwar in der Absicht der Beförderung der öffentlichen Sicherheit geschehen, allein sich nicht begnügen unmittelbare Kränkungen der Rechte der Bürger und des Staats zu bestrafen oder, wenn man grade im Begriff ist, sie zu begehen, zu verhüten. Ich ziehe zugleich alle übrigen hieher, die zwar nicht Sicherheit allein, sondern das Wohl der Bürger überhaupt, indeß das moralische, nicht das physische zum Endzwek haben, weil diese mit den übrigen, von denen ich hier rede, in näherer Verwandtschaft stehen, als mit denen, von welchen ich im Vorigen sprach.
Die sinnlichen Empfindungen, Neigungen und Leidenschaften sind es, welche sich zuerst und in den heftigsten Aeußerungen an den Menschen zeigen. Wo sie, ehe noch Kultur sie verfeinert, oder der Energie der Seele eine andre Richtung gegeben hat, schweigen, da ist auch alle Kraft erstorben, und es kann nie etwas Gutes und Großes gedeihen. Sie sind es gleichsam, welche wenigstens zuerst eine belebende Wärme der Seele ertheilen, zuerst zu einer regen Thätigkeit anspornen. Indeß ist ihr Einfluß in der Intension, wie in der Art des Wirkens unendlich verschieden. Dieß beruht theils auf ihrer Stärke, oder Schwäche, theils aber auch – wenn ich mich so ausdrükken darf – auf der mindern oder größern Leichtigkeit, sie von thierischen Genüssen zu menschlichen Freuden zu erheben. So leiht das Auge der Materie seiner Empfindung die für uns so genuß- und ideenreiche Form der Gestalt, so das Ohr die der proportionirten Zeitfolge der Eindrükke. Ueber die verschiedne Natur dieser Empfindungen, und die Art ihrer Wirkung ließe sich vielleicht viel Schönes und manches Neue sagen, wozu aber schon hier nicht der Ort ist. Nur Eine Bemerkung über ihren Nuzen zur Bildung der Seele. Das Auge, wenn ich so sagen soll, liefert gleichsam dem Verstande einen mehr vorbereiteten Stoff. Das Innre des Menschen wird ihm gleichsam mit seiner, und der übrigen immer von unsrer Phantasie auf ihn bezognen Dinge Gestalt gegeben. Das Ohr weniger. Sie erinnern sich, daß darum Kant die Musik den bildenden Künsten nachsezt. Allein er bemerkt sehr richtig, daß dieß auch zum Maaßstabe die Kultur voraussezt, welche die Künste dem Gemüth verschaffen. Es fragt sich indeß, ob dieß der richtige Maaßstab sei. Meiner Idee nach, ist Energie die erste und einzige Tugend des Menschen. Was seine Energie erhöht, ist mehr werth, als was ihm nur Stoff zur Energie an die Hand giebt. Wie nun aber der Mensch auf Einmal nur Eine Sache empfindet; so wirkt auch das am meisten, was nur Eine Sache zugleich ihm darstellt, und wie in einer Reihe auf einander folgender Empfindungen jede einen durch alle vorige gewirkten, und auf alle folgende wirkenden Grad hat, das, in welchem die einzelnen Bestandtheile in einem ähnlichen Verhältnisse stehen. Dieß alles aber ist der Fall der Musik. Ferner ist der Musik nur diese Zeitfolge eigen, nur diese ist in ihr bestimmt. Die Reihe, die sie darstellt, nöthigt sehr wenig zu einer bestimmten Empfindung. Es ist gleichsam ein Thema, dem man unendlich viele Texte unterlegen kann. Was ihr also die Seele des, der sie hört, und nur überhaupt gleichsam der Gattung nach in einer verwandten Stimmung ist, wirklich unterlegt, entspringt völlig frei und ungebunden aus ihrer eignen Fülle, und so umfaßt sie es unstreitig wärmer, als was ihr gegeben wird, und was oft erst mehr beschäftigt, wahrgenommen als empfunden zu werden. Diese Art zu wirken ist nun nicht der Musik allein eigen. Kant bemerkt eben sie, als bei einer wechselnden Farbenmischung möglich, und in noch höherm Grade ist sies bei dem, was wir durch das Gefühl empfinden. Selbst beim Geschmak ist sie unverkennbar. Auch im Geschmak ist ein Steigen des Wohlgefallens, das sich gleichsam nach einer Auflösung sehnt, und nach der gefundnen Auflösung in schwächern Vibrationen nach und nach verschwindet. Am dunkelsten, und sogar, meinem Gefühl nach, gar nicht bemerkbar ist dieß beim Geruch. Wie nun im empfindenden Menschen der Gang der Empfindung, ihr Grad, ihr wechselndes Steigen und Fallen, ihre – wenn ich mich so ausdrükken darf – reine und volle Harmonie eigentlich das anziehendste, und anziehender ist, als der Stoff selbst, insofern man nemlich vergißt, daß die Natur des Stoffes vorzüglich den Grad und noch mehr die Harmonie jenes Ganges bestimmt, und wie der empfindende Mensch – gleichsam das Bild des blüthentreibenden Frühlings – gerade das anziehendste Schauspiel ist; so sucht auch der Mensch gleichsam dieß Bild seiner Empfindung vor allem andren in allen schönen Künsten. So macht die Mahlerei, selbst die Plastik es sich eigen, das Auge der Guido Renischen Madonna hält sich gleichsam nicht in den Schranken Eines flüchtigen Augenbliks. Die angespannte Muskel des Borghesischen Fechters verkündet den Stoß, den er zu vollführen bereit ist. Und in noch höherm Grade benuzt dieß die Dichtkunst. Ohne hier eigentlich von dem Range der schönen Künste reden zu wollen, erlauben Sie mir nur noch Folgendes, um meine Idee ganz deutlich zu machen, hinzuzusezen. Die schönen Künste wirken durch ein zwiefaches Mittel, durch Materie, und Ausdruck, die ich aber freilich hier in einem weitem und wieder auch geschiednern Sinn, als gewöhnlich nehme. Je mehr der Ausdruck die Materie, und je mehr die Materie den Ausdruck zu Hülfe nimmt, desto mehr schwächt jedes seine eigne Wirkung. Die Dichtkunst vereinigt am meisten und vollständigsten beides, und darum ist sie auf der einen Seite die vollkommenste aller schönen Künste, aber auf der andren Seite auch die schwächste. Weniger lebhaft mahlend als die Plastik, und deren Materie, drükt sie weniger treu nachahmend aus, als die Musik. Die energisch wirkenden sinnlichen Empfindungen aber – denn nur um diese zu erläutern, rede ich hier von Künsten – wirken wiederum verschieden, theils je nachdem ihr Gang wirklich die abgemessensten Proportionen hat, theils je nachdem die Bestandtheile selbst, gleichsam die Materie eindringender ist. So wirkt die gleich richtige und schöne Menschenstimme mehr als ein todtes Instrument. Nun aber ist nie etwas näher als das eigne körperliche Gefühl. Wo also dieses selbst mit im Spiele ist, da ist die Wirkung die höchste. Aber wie immer die unverhältnißmäßige Stärke der Materie gleichsam die zarte Form unterdrükt, so geschieht es auch hier oft, und es muß also zwischen beiden ein richtiges Verhältniß sein. Das Gleichgewicht bei einem unrichtigen Verhältnisse kann hergestellt werden durch Erhöhung der Kraft des einen, oder Schwächung der Kraft des andren. Allein es ist immer falsch, durch Schwächung zu bilden, oder die Stärke müßte denn nicht natürlich, sondern erkünstelt sein. Wo sie aber das nicht ist, da schränke man sie nie ein. Es ist besser, daß sie sich zerstöre, als daß sie aufhöre. Aber genug hievon. Ich hoffe, Sie werden mich verstehn, – obgleich ich gestehe, daß Sie das meiste Licht nun in der nicht eben zufälligen Dunkelheit suchen müssen.
Ich habe bis jezt – obgleich eine völlige Trennung nie möglich ist – von der sinnlichen Empfindung nur als sinnlicher Empfindung zu reden versucht. Aber Sinnlichkeit und Unsinnlichkeit verknüpft ein geheimnißvolles Band, und wenn es unsrem Auge versagt ist, dieß Band zu sehen, so ahndet es unser Gefühl. Dieser zwiefachen Natur der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dem angebornen Sehnen nach dieser, und dem Gefühl der gleichsam süßen Unentbehrlichkeit dieser[x] danken wir alle wahrhaft aus dem Wesen des Menschen entsprungne konsequente philosophische Systeme, so wie alle, auch die sinnlosesten Schwärmereien. Ewiges Streben beide so zu vereinen, daß jede so wenig als möglich der andren raube, schien mir immer das Ziel des menschlichen Weisen. Unverkennbar ist überall dieß ästhetische Gefühl, mit dem uns die Sinnlichkeit Hülle des Geistigen und das Geistige belebendes Prinzip der Sinnenwelt ist. Das ewige Studium dieser Physiognomik der Natur bildet den eigentlichen Menschen. Und hier zeigt sich zugleich wieder der Unterschied der energisch wirkenden und der übrigen sinnlichen Empfindungen. Wenn das lezte Streben alles unsres menschlichsten Bemühens nur auf das Entdekken, Nähren und Erschaffen des Einzig wahrhaft Existirenden, obgleich in seiner Urgestalt ewig Unsichtbaren in uns und andren gerichtet ist, wenn es allein das ist, dessen Ahndung uns jedes seiner Symbole so theuer und gleichsam heilig macht, so treten wir ihm gleichsam einen Schritt näher, wenn wir das Bild seiner ewig regen Energie anschauen. Wir reden gleichsam mit ihm im schweren und oft unverstandnen, aber auch oft mit der gewissesten Wahrheitsahndung überraschenden Gefühl, indeß die Gestalt, wie Plato einmal vom Dichter sagt, um[y] die dritte Stelle von der Wahrheit entfernt ist. Auf diesem Boden zwar nicht allein, aber vorzüglich blüht auch das Schöne, und noch weit mehr das Erhabne auf, das gleichsam den Menschen der Gottheit noch näher bringt. Die Nothwendigkeit eines reinen, von allem Zwek entfernten Wohlgefallens an einem Gegenstande, ohne Begriff, bewährt ihm gleichsam seine Abstammung, seine Verwandtschaft mit dem Unsichtbaren, und das Gefühl seiner Unangemessenheit zu dem überschwenglichen Gegenstande verbindet auf die menschlich-göttlichste Weise unendliche Größe mit hingebender Niedrigkeit. Ohne das Schöne fehlte dem Menschen die Liebe der Dinge, um ihrer selbst willen, ohne das Erhabne der Gehorsam, der jede Belohnung verschmäht, und niedrige Furcht nicht kennt. Das Studium[z] des Schönen gewährt Geschmak, des Erhabnen, wenn es auch hiefür ein Studium giebt und nicht Gefühl und Darstellung des Erhabnen allein Frucht des Genies ist, richtig abgewägte Größe. Der Geschmak allein aber, dem allemal Größe zum Grunde liegen muß, weil nur das Große des Maaßes und nur das Gewaltige der Haltung bedarf, vereint alle Töne des vollgestimmten Wesens in eine reizende Harmonie. Ohne ihn sind die Tiefen des Geistes, wie die Schäze des Wissens unfruchtbar, ohne ihn der Adel und die Stärke des moralischen Willens selbst rauh und ohne erwärmende Segenskraft.
Forschen und schaffen – darum drehen, und darauf beziehen sich wenigstens, wenn gleich mittelbarer oder unmittelbarer, alle Beschäftigungen des Menschen. Das Forschen, wenn es die Gründe der Dinge oder die Schranken der Vernunft erreichen soll, sezt außer der Tiefe einen mannigfaltigen Reichthum und innige Erwärmung des Geistes voraus. Nur der bloß analytische Philosoph kann vielleicht durch die simplen Operationen der nicht bloß ruhigen, sondern kalten Vernunft seinen Endzwek erreichen |sic|[aa] Aber um das Band zu entdekken, das synthetische Säze verknüpft, ist eigentliche Tiefe und ein Geist erforderlich, der allen seinen Kräften gleiche Stärke zu verschaffen gewußt hat. So wird denn – man darf es wohl mit Wahrheit sagen – Kants nie übertroffner Tiefsinn in der Moral und Aesthetik noch oft der Schwärmerei beschuldigt werden, wie er es schon wurde, und wenn Sie mir das Geständniß erlauben – wenn mir selbst einige, obgleich seltne Stellen (ich erinnere Sie an die Deutung der Regenbogenfarben) darauf hinzuführen scheinen; so klage ich allein den Mangel der Tiefe meiner intellektuellen Kräfte an. Also auch um den ruhigsten Denker zu bilden, muß Genuß der Sinne und der Phantasie oft um die Seele spielen. Und wenn Sie von transcendentalen Untersuchungen auf psychologische übergehn, wenn der Mensch, wie er erscheint, Ihr Studium wird, wie wird da nicht der das gestaltenreiche Geschlecht am tiefsten erforschen, am lebendigsten darstellen, dessen eigner Empfindung selbst die wenigsten dieser Gestalten fremd sind?
Daher erscheint der also gebildete Mensch in seiner höchsten Schönheit[ab], wenn er ins praktische Leben tritt, wenn er, was er in sich aufgenommen hat, zu neuen Schöpfungen in und außer sich fruchtbar macht. Die Analogie zwischen den Gesezen[ac] der Plastischen Natur und denen des geistigen Schaffens ist schon mit einem warlich genievollen Blikke beobachtet, und mit treffenden Bemerkungen bewährt worden. Doch vielleicht wäre eine anziehendere Ausführung[ad] möglich gewesen; statt sich auf unerforschbare Geseze der Bildung des Keims einzulassen, hätte die Psychologie vielleicht eine reichere[ae] Belehrung erhalten; wenn das geistige Schaffen gleichsam als eine feinere Blüthe des körperlichen Erzeugens näher gezeigt worden wäre. Um auch in dem moralischen Leben von dem zuerst zu reden, was am meisten bloßes Werk der kalten Vernunft scheint, so macht es die Idee des Erhabnen allein möglich dem unbedingt gebietenden Geseze zwar allerdings – durch das Medium (ein so unendlich glüklich von Ihnen gewählter Ausdruk) des Gefühls – auf eine menschliche und doch – durch den völligen Mangel der Rüksicht auf Glük oder Unglük – auf eine göttlich uneigennüzige Weise zu gehorchen. Das Gefühl der Unangemessenheit der menschlichen Kräfte zum moralischen Gesez, das innige Bewußtsein, daß der Tugendhafteste gleichsam nur der ist, der am tiefsten empfindet, wie hoch das Gesez über ihm erhaben ist[af], erzeugt[ag] die Achtung – eine Empfindung, welche nicht mehr körperliche Hülle zu umgeben scheint, als nöthig ist, sterbliche Augen nicht durch den reinen Glanz zu verblenden. Wenn da das moralische Gesez jeden Menschen als einen Zwek in sich zu betrachten nöthigt; so vereint sich mit ihm das Schönheitsgefühl, das gern jedem Staube Leben einhauchte um auch in ihm an einer eignen[ah] Existenz sich zu freuen, und das um so viel voller und schöner den Menschen aufnimmt und umfaßt, als es, unabhängig vom Begriff, nicht auf die kleine Zahl der Merkmale beschränkt ist, welche der Begriff und noch dazu nur abgeschnitten und einzeln zu umfassen vermag. Die Beimischung des Schönheitsgefühls scheint der Reinheit des moralischen Willens Abbruch zu thun, und sie könnte es allerdings, und würde es auch, wenn dieß Gefühl eigentlich dem Menschen Antrieb zur Moralität sein sollte. Allein es soll bloß die Pflicht auf sich haben, gleichsam mannigfaltigere Anwendungen für das moralische Gesez aufzufinden, die dem kalten, und darum hier allemal unfeinern Verstande entgehen würden, und das Recht genießen, dem Menschen – dem es nicht verwehrt ist für die Tugend Lohn zu genießen, aber wohl die Tugend durch Lohn zu erkaufen – die süßesten Gefühle zu gewähren. Je mehr ich überhaupt über diesen Gegenstand nachdenken mag, desto weniger scheint mir der Unterschied, den ich eben bemerkte, so bloß subtil und vielleicht schwärmerisch zu sein. Wie strebend der Mensch nach Genuß ist, wie sehr er sich Tugend und Glükseligkeit ewig auch unter den ungünstigsten äußern Umständen vereint denken möchte; so ist doch auch seine Seele für die Größe des moralischen Gesezes empfänglich. Sie kann sich der Gewalt nicht erwehren, mit welcher diese Größe sie zu handlen nöthigt, und nur von diesem Gefühle durchdrungen handelt sie, schon darum ohne Rüksicht auf Genuß, weil sie nie das volle Bewußtsein verliert, daß die Vorstellung jedes Unglüks ihr kein andres Betragen abnöthigen würde. Aber diese Stärke freilich gewinnt die Seele nur auf einem dem ähnlichen Wege, von dem ich im Vorigen rede. Alle Stärke – gleichsam die Materie – stammt aus der Sinnlichkeit, und wie weit entfernt von dem Stamm, ist sie doch noch immer, wenn ich so sagen darf, auf ihm ruhend. Wer nun seine Kräfte unaufhörlich zu erhöhen und durch häufigen Genuß zu verjüngen sucht, wer die Stärke seines Charakters oft braucht, seine Unabhängigkeit von der Sinnlichkeit zu behaupten, wer so diese Unabhängigkeit mit der höchsten Reizbarkeit zu vereinen bemüht ist, wessen gerader und tiefer Sinn der Wahrheit un ermüdet nachforscht, wessen richtiges und feines Schönheitsgefühl keine reizende Gestalt unbemerkt läßt, wessen Drang das außer sich Empfundne in sich aufzunehmen, und das in sich Aufgenommne zu neuen Geburten zu befruchten, jede Schönheit in seine Individualität zu verwandeln, und, mit jeder sein ganzes Wesen gattend, neue Schönheit zu erzeugen strebt, der kann das befriedigende Bewußtsein nähren auf dem richtigen Wege zu sein, dem Ideal sich zu nahen, das selbst die kühnste Phantasie der Menschheit vorzuzeichnen wagt.
Ich habe durch dieß an und für sich selbst politischen Untersuchungen ziemlich fremdartige Gemählde zu zeigen versucht, wie die Sinnlichkeit und ihre heilsamen Folgen durch das ganze Leben, und durch alle Beschäftigungen des Menschen verflochten ist. Ihr dadurch Achtung und Freiheit zu erwerben war meine Absicht. Sie mögen über das Gelingen des Versuchs urtheilen. Vergessen darf ich indeß nicht, daß gerade sie auch die Quelle einer großen Menge physischer und moralischer Uebel ist. Selbst moralisch nur heilsam, wenn sie in richtigem Verhältnisse mit den geistigen Kräften steht, erhält sie so leicht ein schädliches Uebergewicht. Dann wird menschlicher Genuß thierische Lust, der Geschmak verschwindet, oder erhält unnatürliche Richtungen, bei welchem leztern Ausdruk ich mich jedoch nicht enthalten kann, vorzüglich in Hinsicht auf gewisse einseitige Beurtheilungen, noch zu bemerken, daß nicht unnatürlich heißen muß, was nicht gerade diesen oder jenen Zwek der Natur erfüllt, sondern was den allgemeinen Zwek derselben mit dem Menschen vereitelt. Dieser aber ist, daß seine denkende und empfindende Kraft, beide in proportionirlichen Graden der Stärke, sich unzertrennlich vereine. Es kann aber ferner ein Misverhältniß entstehen zwischen der Art, wie ein Mensch seine Kräfte ausbildet, und zwischen den Mitteln des Wirkens und Genießens, die seine Lage ihm darbietet, und dieß Misverhältniß ist eine neue Quelle von Uebeln. Nach den im vorigen ausgeführten Grundsäzen aber ist es dem Staate nicht erlaubt, positiv auf die Lage der Bürger zu wirken. Diese Lage erhält also nicht eine so bestimmte und erzwungne Form, und ihre größere Freiheit, wie daß sie in eben dieser Freiheit selbst großentheils von der Denkungs und Handlungs Art der Bürger ihre Richtung erhält, vermindert schon ihr Misverhältniß. Dennoch aber könnte die immer warlich nicht unbedeutende übrigbleibende Gefahr die Idee der Nothwendigkeit erregen, der Sittenverderbniß durch Geseze und Staatsein richtungen entgegenzukommen.
Allein wären solche Geseze und Einrichtungen auch wirksam; so würde nur gerade mit dem Grade ihrer Wirksamkeit ihre Schädlichkeit steigen. Ein Staat, in welchem die Bürger durch falsche Mittel genöthigt oder bewogen würden auch den besten Gesezen zu folgen, könnte ein ruhiger, friedliebender, wohlhabender Staat sein, allein er würde mir immer ein Haufe ernährter Sklaven, nicht eine Vereinigung freier, nur, wo sie die Gränze des Rechts übertreten, gebundener Menschen scheinen, Zwang bringt nie Tugend hervor, und schwächt immer die Kraft, und was sind Sitten ohne moralische Stärke und Tugend? Und wie groß auch das Uebel des Sittenverderbnisses sein mag, es ermangelt selbst der heilsamen Folgen nicht. Durch die Extreme der Dinge müssen die Menschen auf der Weisheit und Tugend mittlern Pfad gelangen. Extreme müssen, gleich großen in die ferne leuchtenden Massen, weit wirken, um den feinsten Adern des Körpers Blut zu verschaffen, muß eine beträchtliche Menge in den großen vorhanden sein. Hier die Ordnung der Natur stören wollen, heißt moralisches Uebel anrichten um physisches zu vernichten.
Wenn ich es daher nicht billige, selbst wirklichem Uebel, sobald es nur noch nicht fremdes Recht kränkt, entgegen zu arbeiten, so schließen Sie leicht, daß ich alle Bildung, welche der Staat durch Erziehung und Religion positiv geben will, misbillige. Ich verweile hiebei auch keinen Augenblik. Alles ist aus dem Vorigen klar. Die nähere Anwendung habe ich schon in dem alten Aufsaz, den Sie kennen, gemacht. Freilich mangelhaft, eben die Mängel dieses Briefes selbst zeigen Ihnen, daß jene Mängel hier nicht wieder ergänzt worden sind. Nur um der Konsequenz willen Eine Bemerkung. Alle Religion – sobald im praktischen Leben davon die Rede ist – beruht auf Empfindung. Wie das Empfindungssystem eines Menschen, so nicht bloß seine Religiosität, sondern so auch sein Religionssystem. Die Nüancen sind unendlich verschieden. Allein folgende zwei Unterschiede wirken doch mächtig. Erstlich der Unterschied der Selbstständigkeit und der hinlehnenden Liebe; zweitens des Gefühls der Kraft des Individuums, und der Schönheit der Einheit in dem Mannigfaltigen. Das Leztere ist gleichsam intellektueller. In beiden führen die beiden ersten Modifikationen allein für sich zum entschiednen Atheismus, die beiden lezten zum entschiednen Theismus. In beiden beides vereint können Atheismus und Theismus hervorbringen, und soll über Werth entschieden werden; so würde ich, da Werth der Religionssysteme immer nach dem Werth der ihnen zum Grunde liegenden intellektuellen und empfindenden Kräfte geschäzt werden kann, dem Theismus und Atheismus, wie er auf die zulezt erwähnte Weise entsteht, den Vorzug vor dem Theismus und Atheismus geben, auf die erstere Weise entstanden. Eine unpartheiische Entscheidung zwischen beiden halte ich für unmöglich. Bei diesem engen Zusammenhange des Empfindungs und Religionssystems würde daher völlige Freiheit des Erstern, und einschränkende Anordnung des Leztern wenn nicht unmöglich, doch gewiß noch mehr als bloß inkonsequent sein. Soviel hievon und nun wiederhole ich bloß das mehr als Einmal gesagte, daß die Religion nur eine ohne alle Aufsicht des Staats zu lassende Gemeineinrichtung sei, und Aufsicht auf Erziehungsanstalten ganz aufhören müßte.
Lassen Sie mich jezt alles zusammennehmen, was ich über die Beantwortung der zweiten Frage gesagt habe. Der Zwek des Staats darf daher nichts anders als die Erhaltung der Sicherheit gegen auswärtige Feinde, und gegen Beeinträchtigungen der Bürger unter einander sein. In diesen Schranken muß er seine Wirksamkeit halten, und selbst in der Wahl der Mittel zu diesem Zwek beschränken ihn eben die Grundsäze, welche ihm keinen andren, als diesen Zwek erlauben. Er darf nemlich – und ich rede hier nun sehr natürlich bloß von der innern Schönheit – keine andre Mittel anwenden als Entscheidung des streitigen Rechts, Herstellung des verlezten, Bestrafung des Verlezers. Verbrechen zuvorkommen dürfte er nur, insofern hinlängliche Merkmale vorhanden wären, daß die Theilhaber sie schon beschlossen hätten.
Dem Einwurfe der Unausführbarkeit überhaupt – denn von der unter diesen oder jenen Umständen, in diesem oder jenem Lande oder Jahrhundert ist hier die Rede gar nicht – zu begegnen mag noch Folgendes dienen. 1., Der Mensch ist an sich mehr zu wohlthätigen, als eigennüzigen Handlungen geneigt. Dies zeigt auch die Geschichte der Wilden. Die häuslichen Tugenden haben so etwas Freundliches, die öffentlichen des Bürgers so etwas Großes und Hinreißendes, daß der bloß unverdorbene Mensch ihrem Reiz selten widersteht. 2., Freiheit erhöht die Kraft und führt, wie immer die größere Stärke, allemal eine Art der Liberalität mit sich. Zwang erstikt die Kräfte, und führt zu allen eigennüzigen Wünschen und allen niedrigen Kunstgriffen der Schwäche. Zwang hindert manche Vergehung, giebt aber allen eine niedrigere Gestalt. Freiheit veranlaßt manche Vergehung, giebt aber allen eine edlere Gestalt. 3., Der sich selbst überlassne Mensch kommt schwerer auf richtige Grundsäze, aber sie zeigen sich unaustilgbar in seiner Handlungsweise. Der absichtlich geleitete empfängt sie leichter, aber sie weichen auch sogar seiner doch geschwächten Energie. 4., Alle Staatseinrichtungen, indem sie ein mannigfaltiges und sehr verschiednes Interesse in Eine Einheit bringen sollen, verursachen[ai] vielerlei Kollisionen. Aus den Kollisionen entstehen Misverhältnisse zwischen dem Verlangen und dem Vermögen der Menschen, und aus diesen Vergehungen. Je müßiger also – wenn ich so sagen darf – der Staat, desto geringer die Anzahl dieser. Wäre es vorzüglich in gegebnen Fällen möglich, genau die Uebel aufzuzählen, welche Polizeieinrichtungen veranlassen, und welche sie verhindern, die Zahl der erstern würde allemal größer sein. 5., Wieviel strenge Aufsuchung der wirklich begangnen Verbrechen, gerechte und wohl abgemeßne aber unerlaßliche Strafe, folglich seltne Straflosigkeit vermag, ist praktisch noch nie hinreichend versucht worden.
Zur Beurtheilung der Französischen Konstitution nach dem hier Entwikkelten kehre ich mehr zurük, Sie um Verzeihung zu bitten, daß ich hierüber nichts zu sagen vermag, als in der That dieselbe wirklich vorzunehmen. Freilich scheint es mir, als wäre auf die Feststellung des Zweks, auf die Bestimmung der Grenzen, nicht einzelner Theile, sondern des Ganzen der Staatsgewalt, wenn nicht gar keine, doch zu wenig Rüksicht genommen; förmlich ist die Abschaffung des Adels, diese willkührliche Vernichtung eines Unterschiedes, den man in Ungerechtigkeit auszuarten, nicht eben ausrotten mußte, meinen Grundsäzen völlig zuwider; endlich könnte ich auch freilich noch einzelne bis jezt überdieß noch nicht völlig genehmigte Projekte, National Erziehung und dergleichen anführen. Allein über alles dieß ist meine Sachkenntniß so mangelhaft, und ich eile zum Ende. Je weniger und mehr als wenig ich indeß hier leiste, desto mehr liegt es mir ob, wenigstens den Umriß des Bildes, das ich vom Staat hier entworfen habe, soviel als möglich zu vollenden. Ich muß daher noch Folgendes hinzusezen.
Auch um den eingeschränktesten Zwek zu erfüllen, muß der Staat hinlängliche Einkünfte haben. Schon meine Unwissenheit in allem was Finanzen heißt, sichert Sie hier vor einem langen Raisonnement. Nur des Zusammenhanges willen muß ich bemerken, daß auch bei Finanzeinrichtungen jene Rüksicht des Zweks der Menschen im Staat, und der daher entspringenden Beschränkung seines Zweks nicht aus der Acht gelassen werden muß. Auch der flüchtigste Blik auf die Verwebung so vieler Polizei mit Finanzeinrichtungen lehrt dieß hinlänglich. Meines Erachtens giebt es für den Staat nur dreierlei Arten der Einkünfte: 1., Einkünfte aus vorbehaltnem oder an sich gebrachtem Eigenthum, 2., aus direkten, 3., aus indirekten Abgaben. Alles Eigenthum des Staats ist schädlich. Schon oben habe ich von dem Uebergewicht geredet, das der Staat, als Staat allemal hat, und ist er Eigenthümer; so muß er in viele Privatverhältnisse nothwendig eingehn. Da also, wo das Bedürfniß, um das man eine Staatseinrichtung wünscht, gar keinen Einfluß hat, wirkt die Macht mit, die nur in Hinsicht dieses Bedürfnisses gewählt wurde. Gleichfalls schädlich sind auch die indirekten Abgaben. Die Erfahrung lehrt, wieviele Einrichtungen ihre Anordnung, und ihre Hebung voraussezt, die das vorige Raisonnement unstreitig nicht billigen kann. Es bleiben also nur die direkten übrig. Unter den möglichen Systemen direkter Abgaben ist das physiokratische unstreitig das einfachste. Allein – ein Einwurf, der vielleicht oft gemacht sein mag, wenn ich ihn auch noch nicht hörte – eines der natürlichen Produkte ist aufzuzählen vergessen worden, die Kraft des Menschen, und da sie in unsren Einrichtungen mit zur Waare wird; so muß sie auch den Abgaben mit unterworfen sein. Wenn man das System direkter Abgaben, worauf ich hier zurükkomme, und nicht mit Unrecht, das schlechteste und unschiklichste aller Finanzsysteme nennt; so muß man indeß auch nicht vergessen, daß der Staat, dem so enge Gränzen gesezt sind, keiner großen Einkünfte bedarf, und daß der Staat, der so gar kein eignes, von dem der Bürger getheiltes Interesse hat, der Hülfe freier, d.h. wohlhabender Bürger mehr versichert sein kann.
So hätte ich die Außenlinien der Gegenstände, die ich behandeln wollte, vollständig gezogen. Indeß meine ich damit nicht, daß nicht noch im Einzelnen ein größeres Detail nöthig gewesen wäre. So bei der Bestimmung der Art, wie der Staat nun für die innre Sicherheit sorgen darf, und sogar muß. Auch was ich hier nur aus dem Gesichtspunkt des Ersprießlichen und Besten betrachtete, müßte es nicht uninteressant sein, aus dem Gesichtspunkt des Rechtes zu prüfen. Beides übergehe ich hier.
Nur Eine Frage muß ich noch beantworten. Ich habe selbst gesagt, daß die Verstärkung des Privatinteresse das öffentliche schwäche, und nun ist meine einzige Absicht darauf hinausgegangen, dieß Privatinteresse nicht bloß zu verstärken, sondern auch zu vervielfachen. Wie wird daher ein solcher Staat irgend bestehen können? Allein wie ich es vervielfacht habe, so habe ich es auch mit dem öffentlichen so genau als möglich verbunden, indem ich gleichsam jenes nur auf dieß, wie es jeder Bürger – da jeder doch sicher sein will – anerkennt, gründete. So dürfte ich also doch vielleicht jene anfangs erwähnte Liebe der Konstitution hier erwarten. Allein, wenn ich auch hierauf nicht rechnen will, so wäre eine Entgegenstellung der Gewalten und dadurch hervorgebrachte Sicherheit gewiß möglich. Dann trift auch hier ein, daß der Staat, der weniger wirken soll, eine geringere Macht, und die geringere Macht eine geringere Wehr braucht. Endlich versteht es sich auch von selbst, daß so wie überhaupt manchmal Kraft oder Genuß dem Resultat geopfert werden muß, um nicht einen größern Verlust zu erhalten, dieß auch hier immer angewandt werden müßte. Wie nun aber die ganze Staatsgewalt richtig vertheilt werden kann, folglich die ganze Diskussion über die Vorzüge der Arten der Regierungsform, übergehe ich hier gleichfalls, und da vielleicht diese eigentlich die Politik ausmacht, bescheide ich mich gern hier gleichsam nur Prolegomena geliefert zu haben.
Ueberhaupt habe ich versucht für den Menschen im Staat die vortheilhafteste Lage auszusuchen. Diese schien mir nun darin zu bestehen, wenn die mannigfaltigste Individualität, die originellste Selbstständigkeit mit der gleichfalls mannigfaltigsten und innigsten Vereinung mehrerer Menschen neben einander aufgestellt würde – ein Problem, welches nur die höchste Freiheit zu lösen vermag. Die Möglichkeit einer Staatseinrichtung, die diesem Ziel so wenig als möglich Schranken sezte, darzuthun, war eigentlich der Endzwek aller dieser Bogen, und ist schon seit längerer Zeit der Endzwek alles meines Nachdenkens. Ich bin zufrieden, wenn ich bewiesen habe, daß dieser Grundsaz wenigstens bei allen Staatseinrichtungen als Ideal vorschweben muß.
Eine große Erläuterung könnten diese Ideen durch die Geschichte und Statistik – beide auf diesen Zwek gerichtet – erhalten. Ueberhaupt hat mir die Statistik oft einer Reform zu bedürfen geschienen. Statt unsichre Data der Größe, der Volkszahl, des Reichthums, der Industrie eines Volkes, aus welchen sein eigentlicher Zustand nie ganz zu beurtheilen ist, an die Hand zu geben, sollte sie , von der natürlichen Beschaffenheit des Landes und der Bewohner ausgehend, das Maaß und die Art ihrer thätigen, leidenden und genießenden Kraft, und nun schrittweise die Modifikationen zu schildern suchen, welche diese Kraft theils durch die Verbindung der Nation unter sich, theils durch die Einrichtungen des Staats erhält. Denn die Staatsverfassung und der Nationalverein sollten, wie eng sie auch oft mit einander verwebt sein mögen, nie mit einander verwechselt werden. Wenn die Staatsverfassung den Bürgern, seis durch Uebermacht und Gewalt, oder Gewohnheit und Gesez, ein bestimmtes Verhältniß anweist; so giebt es außerdem noch ein andres, freiwillig von ihnen gewähltes, unendlich mannigfaltiges und oft wechselndes. Und dieß leztere, das freie Wirken der Nation untereinander, ist es eigentlich, das alle Güter bewahrt, deren Sehnsucht die Menschen in eine Gesellschaft führt. Die eigentliche Staatsverfassung ist diesem – als ihrem Zwekke – untergeordnet, und wird immer nur als ein nothwendiges Mittel, und weil sie allemal Einschränkungen der Freiheit enthält, als ein nothwendiges Uebel gewählt. Die nachtheiligen Folgen zu zeigen, welche die Verwechselung der freien Wirksamkeit der Nation mit der erzwungnen der Staatsverfassung, dem Genuß, den Kräften, und dem Charakter der Menschen gebracht hat, ist daher auch eine der vorzüglichsten Absichten dieser Blätter gewesen.
Burg Oerner, 9. Januar, 1792.Fußnoten
- a |Editor| Der erwähnte Brief an Gentz wurde in leicht veränderter Version in der Berlinischen Monatsschrift, Januarheft 1792, publiziert.
- b |Editor| Wilhelm von Humboldt besaß die elfbändige Plato-Gesamtausgabe, die zwischen 1781 und 1787 von der Societas Bipontiae in Zweibrücken gedruckt wurde und die auf den Arbeiten von Henri Estienne (1531–1598) beruhte (s. AST, Archivmappe 75, M. 4, Bl. 147v unter Nr. 186: "Plato. T. 1–11. Ed. Bip. 1781–1787. 8."). Die "Politeia" erschien als Band 6 und 7 (1785). [FZ]
- c |Editor| Leitzmann 1935b, S. 54 ergänzt zu „Montesquieus“.
- d |Editor| Leitzmann 1935b, S. 55 ergänzt zu „Montesquieu“.
- e |Editor| Leitzmann 1935b, S. 56 ergänzt zu „Montesquieuschen“.
- f |Editor| Nationalversammlung.
- g |Editor| Wohl Druckfehler für "sind".
- h |Editor| Leitzmann 1935b, S. 58 Anm. 2: Verbessert aus "die menschliche Unvollkomm[enheit]".
- i |Editor| Leitzmann 1935b, S. 58 Anm. 4: Verbessert aus "was [für einen]".
- j |Editor| Leitzmann 1935b, S. 59 korrigiert zu "Neueren" und verweist in Anm. 1 auf den verschriebenen Text. Die Korrektur basiert u.a. auf der Parallelstelle in dem 1851 erschienenen Text "Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirklichkeit des Staats zu bestimmen" (GS I, S. 103: "Die Alten suchten Tugend, die Neueren Glükseligkeit.").
- k |Editor| Leitzmann 1935b, S. 59 Anm. 3 verweist auf D. Tiedemann (1786): Dialogorum Platonis argumenta eposita et illustrata, Zweibrücken: Ex Typographia Societatis, S. 179. Dazu GS I, S. 104 Anm.
- l |Editor| Aristoteles, Nikomachische Ethik 10, 7. Humboldt besaß laut dem Bücherverzeichnis in Tegel (AST, Archivmappe 75, M. 4, Bl. 148v) "Aristoteles. Basel. 1550. fol.", dabei handelt es sich um die elfbändige Ausgabe Ἀριστοτελουϛ ἁπαντα. Aristotelis opera quaecumque hactenus extiterunt omnia, quae quidem ut antea integris aliquot libris supra priores editiones omnes a nobis auctae prodierunt, ita nunc quoque, lucis et memoriae causa, in capita diligenter distincta in lucem emittimus, Basel 1550: per Io. Beb. et Mich. Ising. U.a. befand sich in Humboldts Bibliothek die fünfbändige, nicht zu Ende geführte Gesamtausgabe der Werke des Aristoteles von Johann Gottlieb Buhle aus den Jahren 1791–1800, die aber nicht die Nikomachische Ethik enthielt, sowie die erst 1820 erschienene zweibändige Ausgabe der Nikomachischen Ethik von Karl Zell. [FZ]
- m |Editor| Gemeint ist "seine".
- n |Editor| Leitzmann 1935b, S. 64 Anm. 2: Im fünften Buch des Staats (S. 459d).
- o |Editor| Leitzmann 1935b, S. 65 Anm. 1: Verbessert aus "Wirklichk[eit]".
- p |Editor| Leitzmann 1935b, S. 66 Anm. 1: Verbessert aus "Ins[trumenten]".
- q |Editor| Leitzmann 1935b, S. 67 Anm. 1: Verbessert aus "bemer[ken]".
- r |Editor| Gemeint ist "aufstellen".
- s |Editor| Leitzmann 1935b, S. 67 Anm. 3: Wohl verschrieben für "Eigenthümlichkeit".
- t |Editor| Dies ist wahrscheinlich ein Schreibfehler: Gemeint ist wohl Pierre-Ange Romain, der zusammen mit Jean-François Pilâtre de Rozier am 15. Juni 1785 mit einem von letzterem entwickelten Heißluft-Gas-Ballon anstürzte und dabei ums Leben kam.
- u |Editor| Leitzmann 1935b, S. 73 Anm. 5: Im Anfang des dritten Buches (S. 386a).
- v |Editor| Leitzmann 1935b, S. 74 Anm. 2: Verbessert aus "Feinh[eit]".
- w |Editor| Gemeint ist "ab".
- x |Editor| Leitzmann 1935b, S. 78 korrigiert zu "jener".
- y |Editor| Leitzmann 1935b, S. 79 Anm. 2: Verbessert aus "erst" aus "glei[chsam].
- z |Editor| Leitzmann 1935b, S. 79 Anm. 3: Verbessert aus "Gef[ühl]".
- aa |Editor| Der den Satz abschließende Punkt fehlt.
- ab |Editor| Leitzmann 1935b, S. 80 Anm. 3: Verbessert aus "seinem hellesten Lich[te]".
- ac |Editor| Leitzmann 1935b, S. 80 Anm. 5: Verbessert aus "Oper[ationen]".
- ad |Editor| Leitzmann 1935b, S. 80 Anm. 7: Verbessert aus "Be[handlung ?]".
- ae |Editor| Leitzmann 1935b, S. 80 Anm. 8: Verbessert aus "frucht[barere]".
- af |Editor| Leitzmann 1935b, S. 81 Anm. 2: Verbessert aus "die Höhe des Geseze[s]".
- ag |Editor| Leitzmann 1935b, S. 81 Anm. 3: Verbessert aus "gebie[rt]".
- ah |Editor| Leitzmann 1935b, S. 81 Anm. 5: Verbessert aus "neu[en]".
- ai |Editor| Leitzmann 1935b, S. 85 Anm. 4: Verbessert aus "be[wirken]".