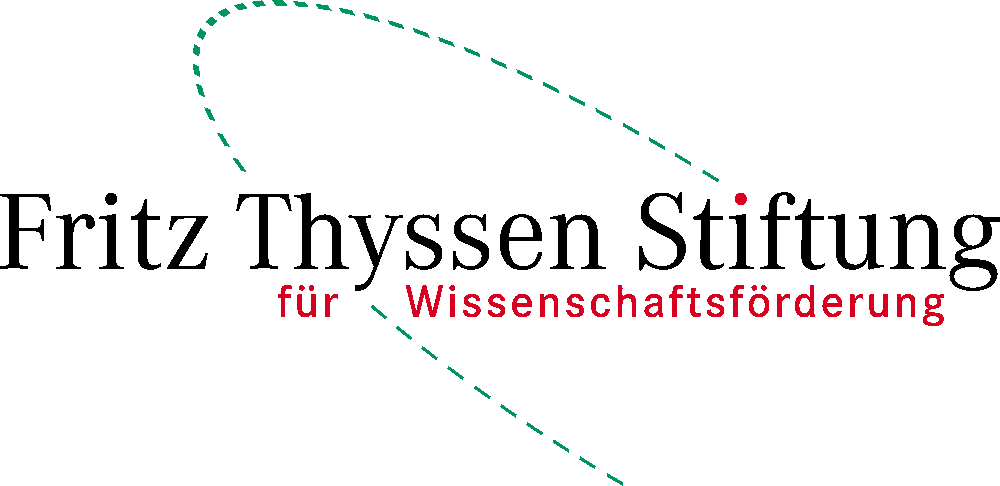Wilhelm von Humboldt an Johann Wolfgang von Goethe, 18.03.1799
|1*|Paris, 18. März, 99.Sie müssen mich für sehr undankbar halten, mein theurer Freund, daß ich so unendlich lange geschwiegen und Ihren lieben gütigen Brief unbeantwortet gelassen habe. Es ist mir ebenso mit Schiller u. Körner ergangen, u. es hat nicht an Vorwürfen gefehlt, die ich mir selbst darüber gemacht habe. Aber die Reue führt so selten zur Besserung, und dann liegt in dem Reisen selbst etwas, das die häufigere Mittheilung durch Briefe verhindert. Es ist nicht die Entfernung bloß, es ist bei weitem mehr der angenehmere Gedanke des bevorstehenden Wiedersehens. Nur indem man die Reise als etwas bald Vorübergehendes ansieht, kann man es ertragen, eine lange längere Zeit hindurch ohne wechselseitige Mittheilung zu bleiben.
Daß ich mich darum in Gedanken nicht weniger mit Ihnen, mit dem, was Sie treiben, was Sie interessirt, beschäftigt habe, bedarf gewiß keiner Versicherung. Wie Sie selbst <sogar> die Beschränktheit meiner Natur kennen, müssen Sie fühlen, daß mir alles, was mich außerhalb Deutschland umgeben kann, doch immer heterogen bleibt, und was mich an Deutschland knüpft, was ist das andres, als was ich aus dem Leben mit Ihnen, mit Schiller, mit dem Kreise schöpfte, dem ich nun schon seit beinahe zwei Jahren entrissen bin. Wer sich mit Philosophie und Kunst beschäftigt, gehört seinem Vaterlande noch eigenthümlicher als ein anderer an. Dies habe ich auch noch hier an Alexander und mir erfahren. Ich war vielleicht eben so gern, vielleicht noch lieber in Paris, als er, allein er war unendlich weniger fremd hier. Mittheilung und Erwiderung fanden für ihn kaum nur ein Hinderniß. Philosophie und Kunst sind mehr der eignen Sprache bedürftig, welche die Empfindung und die Gesinnung sich selbst gebildet haben, u. durch die sie wieder gebildet worden sind. Die feinsten u. doch bedeutendsten Nuancen, das, was in der Sprache kaum noch Symbole genannt werden kann, geht bei jeder Uebertragung verloren, und selbst wenn es nicht verloren geht, macht es einen schwächeren |2*| Eindruck. Läßt sich daher zugleich annehmen, daß jede Nation ihre eigene Sprache ausschließender ausbilden u. daß alle gerade in der Philosophie u. Kunst Fortschritte machen werden, so muß gerade mit der zunehmenden Leichtigkeit allgemeinerer Mittheilung das innigere Verstehen verschiedener Nationen schwerer u. das Bedürfniß danach allgemeiner werden. Jede muß bestimmtere Charakterzüge annehmen, u. ihre Verschiedenheit muß zunehmen, wie sie denn offenbar in diesem Jahrhundert bereits zugenommen hat.
Die Eigenthümlichkeit deutscher Bildung und wie sehr wir in der bessren Ansicht der Kunst unsren Nachbarn vorgeeilt sind, davon sind mir noch neuerlich Ihre Propyläen ein auffallendes Beispiel gewesen. Für alles, was sie <Sie> in den beiden ersten Stücken (die mir bis jetzt allein zu Gesichte gekommen sind) theils ausführen, theils berühren, hat man hier so gut als gar keinen Sinn.[a] Noch so zweckmäßig übersetzt, würde man es kaum verstehen, u. ihm vielleicht noch weniger Geschmack abgewinnen. Sie erheben sich z. B. mit Recht gegen Diderots wirklich anarchistische Grundsätze in der Kunst; aber wenn man die Menschen u. ihre Arbeiten hier sieht, u. dann hinzudenkt, daß es vor dreißig Jahren hierin noch ärger war, so begreift man wenigstens, wie dieser Abweg für Diderot näher lag, als ein andrer. Dieser Aufsatz über Diderot hat mich vorzüglich interessirt. Ich hatte gerade die ganze neue Ausgabe seiner Werke (in 15. Bänden) gelesen, als ich dazu kam, u. die in der That auffallende Erscheinung, daß Diderot einem oft so künstlerisch gebildet vorkommt, u. dann doch offenbar zum Künstler (in jedem Verstände des Worts) so untauglich ist, hatte mich dergestalt frappirt, daß ich selbst angefangen hatte, etwas über ihn zu schreiben. Wirklich ist mir nie ein Subject vorgekommen, an dem sich das wahre Wesen einer ächt künstlerischen Ein-|3*|bildungskraft besser, durch die Darstellung des Gegentheils, zeigen ließe, als er. Es käme nur darauf an, die Eigenthümlichkeit seines Geistes, die besondre Art der Phantasie, die ihn zu einem seltenem Menschen macht, die Geistesthätigkeit, in der er Virtuose ist, bestimmt u. deutlich auseinanderzusetzen. Ist es Ihnen nicht auch aufgefallen, daß er an keiner Stelle das ist, was er gerade an dieser seyn sollte? Wenn er philosophirt, so macht er Bilder, statt Begriffe zu zergliedern; wenn er dichtet, so läßt er seine Personen raisonniren, statt handeln, wenn er Gemälde beurtheilt, so behandelt er sie als Gedichte, u. Ge die Gestalten des Dichters trägt er auf die Leinwand über. Einer Kunst schiebt er immer unvermerkt die andere unter und doch ist er schwerlich gemacht, als partheiloser Richter über allen zu stehen. Denn er fühlt, wie es scheint, eben so wenig ihre Eigenthümlichkeit, als das, was sie alle zur Kunst macht. Die eigentliche, tiefe Wahrheit der Dinge, die auf der Bedeutung ihres Ganzen, ihrem Zusammenhänge unter einander u. vorzüglich ihrer Beziehung auf unsre Vorstellungs- u. Anschauungsweise beruht, ist ihm durchaus fremd. Er ergründet sie nicht als Philosoph, er stellt sie als Dichter nicht dar, er fühlt sie nicht in den Meisterwerken der Kunst. Aber auf die Wahrheit, die man als Natur der Künstelei u. als Wirklichkeit dem Zeichen entgegensetzen kann, ist sein ganzer Sinn, seine Phantasie, sein Geist gerichtet, u. darum bleibt er immer eine merkwürdige Erweiterung der <des> französischen Na Charakters. Darum ist er gerechter gegen das Alterthum u. das Ausland, u. selbst wohlthätig für die Kunst, da er, wenn er gleich ihrer Gesetzmäßigkeit schadet, wenigstens ihre Freiheit rettet. Zugleich aber zeigt den ächten Charakter seiner Nation die fast ausschließliche Ueberlegenheit des Verstandes. Es fehlt ihm die höhere Anschauungsgabe, die bildende Einbildungskraft, von der doch wenigstens ein Theil von den |4*| Griechen auf die Germanischen Nationen forterbte, es fehlt ihm die üppige reiche Sinnlichkeit der Bewohner des Mittags, er bleibt immer nur raisonnirend u. vergleichend. So sehr er auf Natur auszugehen scheint, so ist es nicht auf die Natur an sich u. in ihrer positiven Gestalt, sondern auf ihren Contrast mit der Unnatur, so wie ihm die Wirklichkeit immer nur im Contrast mit ihren Zeichen erscheint. Seine Stärke besteht wohl allein im Sprechen u. Raisonniren, im beständigen u. genievollen Verwechslen aller Bilder u. aller Zeichen mit einander, in der seltenen Gabe schneller u. allgemeiner Verknüpfung der verschiedenartigsten Gegenstände, in dem Talent jedem Gedanken Farben zu leihen, u. durch jede Farbe den Gedanken hervorschimmern zu lassen, u. in dem, was mir in der That Genie scheint: dies wunderbare oft willkürlich u. zwecklos scheinende Spiel auf eine solche Weise zu treiben, daß nicht bloß der unbedeutendere Leser daraus Vergnügen, sondern der bedeutendste eine bessere u. fruchtbarere Stimmung schöpft. Ich erinnere mich kaum je aus einem Diderotschen Aufsatz etwas gelernt zu haben, aber seine Lektüre hat mich immer in eine regere * Geistesthätigkeit versetzt, u. dasselbe hat mir auch Schiller oft von sich bezeugt. Diese Wirkung setzt immer Objectivität in dem voraus, der sie hervorbringt u. verräth recht eigentlich Genie, da sie ohne Mitwissen ihres Urhebers entsteht. — Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, mich Ihnen deutlich zu machen, aber sehr gern wüßte ich Ihre Meynung hierüber. Wenige Dinge in der Psychologie sind so wichtig u. vielleicht keins so schwer, als die gründliche Erörterung der Einbildungskraft, u. die <besondre Art derselben>, die ich in Diderot zu entdecken glaube, erläutert darum so gut fast alle anderen, weil sie sich, meiner Empfindung nach, fast allen andren A entgegensetzt.
Auch in jeder andren Hinsicht sind mir Ihre Propyläen eine äußerst willkommene Erscheinung gewesen. Die Kunst bedurfte einer solchen Arbeit, u. |5*| sie konnte nur von Männern unternommen werden, die selbst mit dem Détail u. der Ausführung so vertraut sind. Besonders habe ich bewundert, wie individuell u. dem Kritiker, wie dem Künstler unmittelbar brauchbar Sie Ihre Theorien zu machen verstanden haben. Schriften über die bildende Kunst sind sonst gewöhnlich so unbrauchbar für den ausübenden Künstler; aber die Ihrige ist überall reich an praktischen Winken, an anschaulichen Beispielen, an einer großen Mannigfaltigkeit von Thatsachen. Selbst die Grundbegriffe der Kunst, ihre höchsten Gesetze haben Sie, ohne ihrer Reinheit zu schaden, in eine unmittelbar verständliche Sprache übersetzt, u. ich zweifle, daß sich in diesen beiden Stücken irgend etwas fände, wofür wovon der Künstler nicht gleich die Anwendung vor sich erblickte. Ueberaus reich an glücklichen Bemerkungen hat mir der Aufsatz über die Wahl der Gegenstände geschienen. Nur weiß ich nicht, ob Sie nicht in Rücksicht der historischen ein wenig zu streng urtheilen, wenn Sie verlangen, daß sie zugleich von den Motiven der Handlung Rechenschaft geben sollen. Da jedes historische Gemälde nothwendig immer zugleich Charakterbild ist, da es außerdem, wenn es der Maler gut behandelt hat, schon dem bloßen Auge interessante u. angenehme Stellungen und Gruppen darstellt; so dünkt mich, ist es genug, wenn es übrigens insofern durch sich allein verständlich ist, daß die physische Handlung vollkommen daraus klar wird, u. daß diese auch schon an u. für sich sinnlich oder moralisch bedeutend ist. Die historische Bedeutung kann dann freilich nicht viel mehr hinzufügen, als die Figuren unter den einmal bekannten Namen dem Gedächtniß fester einzuprägen.
Ihre Beiträge zum Almanach haben uns ein sehr großes Vergnügen gewährt. Vor allem die größere Elegie, die unaussprechlich anziehend |6*| ist. Sie hat schon in der Erfindung, der einzelnen Schönheiten nicht zu gedenken, eine so ächt antike Wendung, daß sie die große Rührung, die sie hervorbringt, gerade auf den schwer zu treffenden Punkt des ächt Künstlerischen zurückbringt. Wenn Ihnen, wie man mit Grunde hoffen darf, das Schicksal vergönnt, noch lange so, wie Sie bis jetzt gethan haben, theoretisch und praktisch fortzufahren, so glaube ich, darf man sich versprechen, das wahre Wesen der Kunst, besonders die feine Grenze, wo sie mit der Natur zusammenstößt u. sich von ihr entfernt, klar u. bestimmt zu erblicken, u. gelingt dieß, so geht damit zugleich eine neue Epoche für die Kunst an. Kein großer Dichter wirkt anders, als durch eine vermöge der Kunst erhöhte u. eigen zubereitete Natur; aber aus Ihren Werken stralt |sic| noch außerdem ein gewisser magischer Wiederschein |sic| der Kunst selbst (im höchsten Verstande des Worts) zurück. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie diese Erscheinung psychologisch zu erklären sey. Ihre Beschäftigung mit der bildenden Kunst hat unstreitig großen Antheil daran, allein sie ist selbst mehr eine Folge, als eine Ursach dieser Geistesstimmung. Wenn es erlaubt wäre, in dem Genie eine zeugende u. eine bildende Kraft zu unterscheiden, so würde ich Ihnen ein Uebergewicht der letzteren zuschreiben. Und sollte nicht in dieser Trennung dennoch einige Wahrheit liegen? Ist nicht Shakespeare u. unter uns Klopstock heftiger u. voller ausströmend, wie die Dichtung der Griechen, die sich ruhig u. still aus sich selbst entfaltet? Muß nicht diese letztere, auch vollendet, die Spuren dieses bildenden Geistes an sich tragen? und ist jenes unmittelbarere Bewußtseyn der Kunst in den Werken der Alten etwas andres, als das lebendigere Gefühl der Wirksamkeit u. der Gegenwart ihres alles beseelenden Kunstsinns? — Ueberraschend u. wunderbar zugleich ist es, |7*| diese ächt griechischen Produkte neben den modernen Balladen zu sehen. Sie haben einen eignen u. sonderbar anziehenden Ton, vorzüglich die vom Mühlbach, die eine ganz eigne Herzlichkeit u. Naivetät besitzt.
Schiller schreibt mir, daß Sie Rétifs Mr. Nicolas sehr lieben, u. etwas von dem Mann selbst zu erfahren wünschen. Seine Armuth, Kränklichkeit u. Sonderbarkeit machen es schwer ihn zu sehn, doch habe ich vor mehreren Monaten einmal einen Abend ziemlich allein mit ihm zugebracht, u. kann Ihnen also wenigstens etwas von seinem Aeußren sagen. Er ist klein, aber fest u. stark gebaut. Sein Gesicht ist sehr auffallend, u. verräth deutlich, daß er aus einer Provinz stammt, die sich, wie es mir vorkommt, durch freie, ofne, u. kräftige Naturen auszeichnet. Es ist ein mäßig langes Oval, mit hochgewölbter Stirn, einer großen gebogenen Nase, u. feurigen schwarzen Augen. Trotz seiner ungewöhnlich starken schwarzen Augenbrauen, von denen das |sic| eine lang über das Auge herüber hängt, hat er dennoch nichts Wildes oder Hartes in seiner Physiognomie; aber sehr viel Freimüthigkeit, ofne Heiterkeit, gutmüthige Redlichkeit u. ein unbeschreibliches Feuer. Diesem Ausdruck entspricht auch seine Art zu reden. Er spricht viel, laut, mit Heftigkeit u. ohne allen Rückhalt. Seine Unterredung ist interessant, weil sie seinen Charakter, der so entsetzlich mit allem contrastirt, was man sonst hier sieht, lebendig malt. Die Stärke, mit der er sich ausdrückt, die Heftigkeit in die er gleich geräth überrascht. So sagte er von einem Menschen, der bei einem sehr schlüpfrigen Roman, den er ihm vorgelesen, kalt geblieben war, c’est une ame de bois. Mais je déteste depuis tout ce qui est blond. Ce sont des ames molles, des ames d’éponges u. was der Beiwörter mehr waren. Dem alten Mercier, der zugegen war, u. der nun freilich sehr weit von aller Energie entfernt ist, sagte er|,| ich weiß nicht mehr bei welcher Gelegenheit, ordentlich mit einer Art von Zo zorniger |8*| Ungeduld: mais ayez donc, ayez, je Vous en prie, une fois de grandes idées. Die Innigkeit, mit der er von seiner Mutter, seinem Vater, seinen Jugendjahren spricht, rührt; eine Art sentimentaler Schwärmerei (so erzählte er mir unter andrem eine Vision, die er in der Kirche zu Auxerre gehabt) reißt hin. Ueberhaupt findet man die Züge wieder, die man in seinen Schriften kennt, die starke u. noch immer rege Sinnlichkeit, die Freimüthigkeit, den Familienstolz u. s. f. Dagegen aber ist mir der Inhalt seines Gesprächs nur wenig anziehend gewesen. Trotz einer großen Beweglichkeit der Einbildungskraft hat er doch, wie es scheint, keine große Geistesthätigkeit. Sein so Erfahrungsreiches Leben hilft in der Unterredung nicht aus, da er immer da nur, wie er auch oft thut, sagen kann, was man besser in seinen Schriften liest, u. außerdem verfällt er nur zu leicht in zwei Gegenstände, die nichts weniger, als fruchtbar oder belehrend sind. Der eine ist seine jetzige beschränkte Lage, die ihn gleich zu weitläuftigen Erzählungen vermeintlicher Cabalen u. Verfolgungen seiner Feinde, der Buchhändler u. der andren Schriftsteller (eine Krankheit der Einbildungskraft, die hier gewöhnlicher, als bei uns scheint) verleitet. Dem äußren Anblick nach scheint seine Armuth in der That groß u. beklagenswerth. Er [trägt] trug Er ist äußerst dürftig u. ganz altmodisch gekleidet, schreibt, wie man erzählt, seine Mscrpte auf Papieren, die er auf der Straße zusammensucht u. dann zu Hause troknet u. s. w. Indeß behaupten andre, daß hieran auch eine Art cynischer Verwöhnung Schuld sey. Der zweite Lieblingsgegenstand seiner Gespräche sind seine philosophischen u. physikalischen Systeme. Diese scheinen auf den ersten Anblick mehr zu versprechen. Wenn er einem sagt, daß die Seele aus 210 Elementen (nicht mehr u. nicht weniger bestehe) |sic| daß aber ihr, so wie aller Geister u. der Gottheit ursprüngliches Element das Salz sey; daß der Tod nur eine Rückkehr in das allgemeine |9*| oder vielmehr Totalleben ist u. s. f. so erstaunt man allerdings zuerst, aber läßt man sich auf die Gründe dieser Behauptungen ein, so fällt die Verwunderung gar sehr. Wenigstens ist es mir nicht gelungen in der Ausführung dieser Paradoxen auch nur kühne, subjectiv u. psychologisch interessante Behauptungen u. Wendungen zu finden. Sein ganzes physiko-philosophisches System hat er in drei Werken, jedes von 4 Bänden, die indeß alle noch Manuscript sind u. bei seinem Mangel an Mitteln, sie drucken zu lassen, es wohl immer bleiben möchten, auseinandergesetzt. Ihre Titel heißen mille & un développemens[b], les lettres des tombeaux,[c] l’enclos des oiseaux[d]. Sie haben alle eine dichterische Einkleidung u. sind zugleich Romane. Das erstere führt seinen Titel recht eigentlich. Denn er hat jeden Morgen ein Kapitel geschrieben, u. da er, wie er mir selbst sagte, oft nicht gewußt, was er darin sagen sollte, so hat ihm die wiederholte Durchlesung des zunächst vorhergehenden immer einen leicht weiter zu entwickelnden Stoff gegeben. Er hält dies Werk für so wichtig, daß er mir versicherte, es müßte nicht nur auf Kosten der Regierung, sondern der Menschheit gedruckt werden. Dieser u. andrer Sonderbarkeiten ungeachtet, wäre es indeß gewiß sehr dankbar, diesen wirklich seltnen Mann öfter zu sehen; nur ist das beinah eine unmögliche Sache. In seinem Hause geht es, wie man mir allgemein sagt, seiner häuslichen Lage wegen, gar nicht an. Man muß ihn also in einem Cafféhause aufsuchen, in dem er meist täglich Schach spielt. Da findet man sich in einer engen Stube mit einer Menge von Leuten zusammen, u. diese Umgebungen verleiden einem unläugbar in hohem Grade den Genuß des Gesprächs mit ihm selbst. Dies Cafféhaus scheint übrigens ein rendez-Vous noch andrer Dichter u. Gelehrten, die wenn sie Rétif an Genie nicht gleich kommen, ihm wenigstens in der äußren Lebensart ähnlich sind. Er zeigte mir Komödien u. Tragödiendichter, von denen sonst nie-|10*|mand je gehört hat. Aber da habe ich Ihnen so viel von Einem Abend erzählt, daß Schiller, wenn er dies le vielleicht liest, diesen Abend mit der berühmten Stunde vergleichen wird, die einmal Woltmann mit meiner Frau zugebracht hat. – Retifs coeur humain dévoilé hat auch auf mich einen außerordentlichen Eindruck gemacht. Ich zweifle, ob es sonst noch irgendwo ein Buch geben mag, in dem so vieles, so wahres u. so individuelles Leben zu sehen ist. Man kann es keine Dichtung nennen, auch dem Vf. kaum einmal Dichtungsvermögen darum zuschreiben. In der That scheint er dessen nicht viel zu haben, wenn man bedenkt, daß alle seine bändereichen Romane doch großentheils nur Wiederholungen von Scenen sind, welchen einige Wirklichkeit wenigstens zum Grunde liegt. Auf der andren Seite halte ich freilich auch die historische Wahrheit wenigstens nicht durchaus für streng, u. möchte das Buch nicht geradezu als Selbstbiographie psychologisch brauchen. Auch geben Rétifs Freunde ihm Schuld, daß er Begebenheiten erdichtet u. hernach selbst steif u. fest glaubt. Aber die eigentliche allgemeine innere Wahrheit, die auf der einen Seite tr der Natur treuer ist, als die der immer idealisirenden Kunst, auf der andren aber reicher, mannigfaltiger u. übereinstimmender mit sich selbst|,| als es möglich ist|,| die nackte historische zu geben, die ist es gerade, die ich in ihm finde. Er hat, was er schreibt, wirklich empfunden, wirklich in seinem Selbst, in seiner Einbildungskraft erfahren, es ist ihm ganz eigentlich Erfahrung u. als solche eigen geworden, die äußren Gegenstände mögen auch mehr oder minder anders in der Wirklichkeit gewesen seyn, als er sie darstellt. Und in dieser Art, so das Leben aufzufassen, so die Charaktere hinzustellen, die Empfindungen so innig u. so rührend zu schildern, als z. B. seine Anhänglichkeit an sein Schäferleben, an das kleine Thal, die wehmüthige Erinnerung daran durch den Teppich in der Klosterschule geschildert |11*| ist, verräth einen Grad eigenthümlichen Genies, der um so mehr überrascht, als hier seltner gefunden wird. Und ist Ihnen nicht auch diese Verschiedenheit der Sitten von dem, was wir uns sonst als französisch denken, aufgefallen. Wo ist der Kreis geblieben, in dem diese Naivetät, diese Unschuld, dieser wirkliche Adel der Gesinnung, diese unläugbare Sentimentalität herrschte, die wir in diesen Schilderungen bewundern? Lebt er noch in diesen abgelegenen Thälern, die nur eine mäßige Entfernung von der so ganz heterogenen Pariser Welt scheidet? oder ist diese Verschiedenheit der jener Zeit, dem Ablauf eines halben Jahrhunderts zuzuschreiben. In der That fühlt man sich durch diese Schilderungen näher an Montaigne’s als an unsre Zeiten versetzt. Es sind weibliche Charaktere von einer Stärke u. Zartheit darin, die man sonst vergebens sucht. So z. B. die Margarethe, die Entdeckung ihrer Schwangerschaft, ihre Trennung von dem Rétif in den Ruinen der Kapelle. Und was haben sie <Sie> zu den Spielen u. Volksliedern gesagt? Hat nicht das eine von dem Unglück der Stieftochter eine nordische Schwermuth, wie ich sie mich in einigen Lettischen Volksliedern gefunden zu haben erinnere. Wie man auch über die Wahrheit oder Fabelhaftigkeit dieses Buchs urtheilen mag, so wird der, der es nicht gelesen hat, den Französischen Charakter immer mangelhaft u. einseitig beurtheilen.
Von hier kann ich Ihnen sonst wenig sagen, theurer Freund. Ueber den Kunstkörper hier, wie Sie es in Ihren Propyläen nennen, ließen sich aufs Höchste nur fragmentarische Nachrichten geben. Zwar haben wir, da wir mit den hiesigen Künstlern sehr bekannt sind, die angekommenen Gemälde alle gesehen, indeß, da sie bis jetzt theils noch gar nicht, theils nur provisorisch aufgestellt sind, so ist es nicht möglich, jetzt schon das Ganze zu übersehen, u. genau, wieviel u. in welchem Zustande hier angekommen ist, zu bestimmen. Da jetzt wahrscheinlich auch Florenz seine besten |12*| Sachen wird hergeben müssen, so kommt freilich hier ungeheuer viel zusammen; nur ist es Schade, daß in der großen Galerie wegen der auf beiden Seiten befindlichen Fenster eine sehr ungünstige Beleuchtung ist. Die Französische u. Flamändische Schule wird in wenigen Tagen, vollkommen geordnet zu sehen seyn u. nun ist man mit der Italiänischen beschäftigt. Die Bildsäulen sind noch immer eingepackt; auch hieß es noch vor wenigen Wochen, daß z. B. der Apoll[e] vor dem Herbst nicht zu sehen seyn werde. Neuerlich aber hat der Minister des Inneren, der ein äußerst thätiger Mann ist, die Sache ernstlich betrieben u. man redet von 6–8 Wochen.
Ob wir ihn noch hier jetzt sehen werden, ist so wie unsre Abreise von hier noch ungewiß. Vermutlich wenden wir uns in der beinah absoluten Unmöglichkeit Italien zu sehen, nach Spanien u. bringen den Winter in Valencia zu. Ob wir aber in 4 Wochen oder erst in einigen Monaten abgehen, müssen die Umstände entscheiden.
Mein Bruder reiste, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, im October von hier nach Marseille, um von da in die Berberei zu gehn. Die Feindseligkeiten zwischen Algier u. Frankreich haben diesen Plan vereitelt. Er ist jetzt seit einigen Monaten in Spanien u. in diesem Augenblick in Madrid. Er sucht Erlaubniß, nach Mexico zu gehen u. denkt sich, wenn er sie erhält, in Kurzem in Coruna einzuschiffen. Doch wissen Sie, wie ungewiß jetzt alle Plane sind. Er bittet mich sehr oft, sein Andenken bei Ihnen zu erneuern.
Ich lege diesem Briefe einige Scenen des Agamemnon bei.[f] Es ist alles, was ich hier habe zu Stande bringen können. Sie glauben nicht, wie schwer sich so etwas hier, auf so unantikem Boden, arbeitet. Da Sie einmal dieser Arbeit eine so gütige Theilnahme geschenkt haben, so bitte ich Sie recht herzlich um Ihr leitendes Urtheil über dies Stück. Ich bin selbst nicht recht damit zufrieden, u. die Furcht mehr zu verderben, hat mich mit abgehalten, ernstlicher weiter zu gehen. — Meine Frau grüßt Sie herzlich. Wie unendlich freuen wir uns der Zeit, wo wir wir |sic| wieder in Ihrer Nähe seyn werden. Tausend Grüße an Schiller!
H.
|Links am Rand, von oben nach unten geschrieben| Ich ließ diesen
Brief einige Tage liegen, weil ich Hofnung hatte, ihn mit einem Reisenden
abgehen zu lassen. Da dies aber fehlgeschlagen ist, muß ich ihn schon der
Post anvertrauen. — Der Apoll[g] ist leider, wie mir eben Pajou sagt, seiner Erlösung nicht so
nahe, als ich dachte. — Ihre Briefe, lieber Freund, seyn Sie so gütig immer
hieher, aber unter Brinckmanns Adresse à Mr. de Brinckmann de la légation Suédoise, à Paris, rue
de Grenelles, nr. 103. zu schicken. Ich erhalte sie so auf jeden
Fall. Grüßen Sie Schiller u. Meyer herzlich von uns allen u. leben Sie
wohl!
Fußnoten
- a |Editor| Die Beiträge in den Propyläen 1798 lauten: Erstes Stück: Ueber Laokoon; Ueber Gegenstände der bildenden Kunst; Ueber Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke; Ueber etrurische Monumente; Rafaels Werke besonders im Vatikan. – Zweites Stück: Diderots Versuch über die Mahlerey; Von den Gegenständen der bildenden Kunst; Rafaels Werke besonders im Vatikan (Fortsetzung); Ueber Holzschnitte; Einige Bemerkungen über die Gruppe Laokoons und seiner Söhne. [FZ]
- b |Editor| Das Werk ist verloren; siehe Charles A. Porter (1967): Restif’s Novels, or: An Autobiography in Search of an Author, New Haven / London: Yale Univiversity Press, S. 390. [FZ]
- c |Editor| Die Lettres du tombeau erschienen 1802 in vier Bänden unter dem Titel Les Posthumes, lettres reçues après la mort du mari, par sa femme qui le croit à Florence, par feu Cazotte. [FZ]
- d |Editor| Der Roman L’enclos et les oiseaux blieb unpubliziert und muss wohl großteils als verloren gelten. Vier Bogen (d.h. 16 Seiten) des Manuskripts gelangten im Jahr 2006 bei Sotheby’s in Paris zur Auktion (http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2006/books-and-manuscripts-pf6008/lot.52.html). [FZ]
- e |Editor| Der Apoll vom Belvedere; siehe den Brief Humboldts vom 25. März 1798. [FZ]
- f |Editor| Beigefügt sind dem Brief die 9. bis 11. Szene (V. 792–1042) der Agamemnon-Übersetzung, in einer sehr frühen Fassung. [FZ])
- g |Editor| Siehe oben.