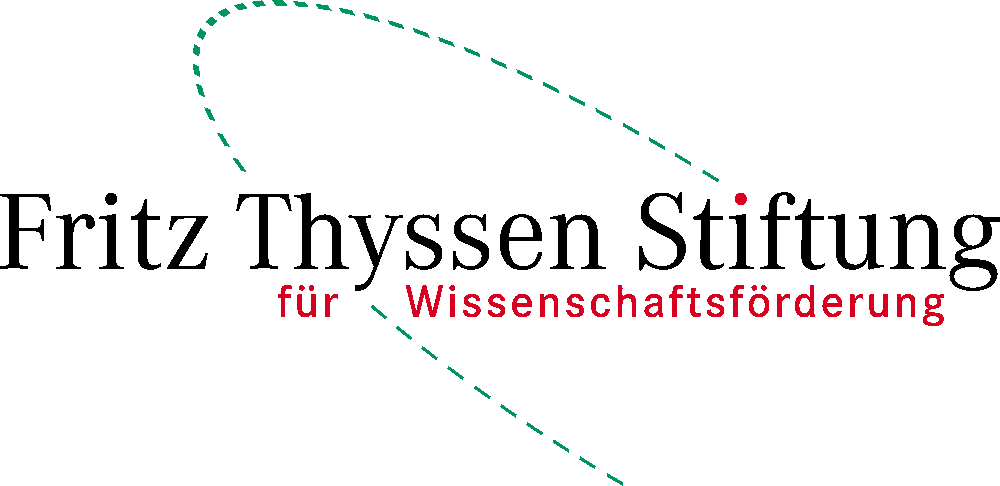Wilhelm von Humboldt an Friedrich Schiller, 14.09.1795
Tegel, 14. Sept. 95.Den letzten Sonnabend, an dem ich Ihnen schrieb, lieber Freund, habe ich noch eigne Abentheuer gehabt. Gleich nachdem ich Ihr Geschäft bei Unger abgemacht hatte, ritt ich fort. Aber unterwegs begegnete mir ein Bote meiner Frau. Unser kleiner Junge war den Morgen sehr krank geworden, u. sein Zustand schien in der That einen Augenblick sehr bedenklich. Ich kehrte also wieder um u. sprach erst mit dem Arzt, u. ritt dann hier heraus. Bei meiner Ankunft fand ich das Kind zwar besser u. außer Gefahr, aber meine Mutter abermals krank, u. so ist der Sonnabend wie der gestrige Tag mit vielen durch diese Umstände verursachten Störungen verstrichen. Der Junge leidet zugleich an starkem Husten u. Zahnen, jedoch glaubt der Arzt nicht, daß es von Dauer seyn wird. Mit meiner Mutter steht es noch ebenso u. es ist nichts zu thun, als abzuwarten.
Möchten nur Sie, lieber theurer Freund, recht wohl u. heiter seyn, das denke ich so oft hier, wenn ich mich mit Ihnen u. Ihren Arbeiten beschäftige. Ich denke der hier ungewöhnlich gute September soll Ihnen heilsam seyn, u. wahrscheinlich besucht auch Göthe Sie jetzt bald auf längere Zeit.
Ich habe seit neulichem Posttag die beiden Horenstücke durchgelesen, u. einige Sachen haben mir viel Vergnügen gemacht. Der Erhardische Aufsatz ist zwar, als Fragment, am wenigsten befriedigend, es ist nicht leicht, das Resultat recht rein aufzufassen, u. für die Kürze, welche die Abhandlung nun hat, beschäftigt sie sich zu viel von Anfang herein mit der Republik, die noch dazu ziemlich bekannt ist. Indeß ist die Idee, die im Ganzen herrscht, sehr wichtig u. mit vielem Scharfsinn auseinandergesetzt. Selbst der Vortrag hat mir stellenweis sehr gut gefallen. Ich wünschte sehr, die Folge seiner Gedanken zu kennen, vorzüglich um seine Meynung über die Platonische Schrift genauer zu prüfen. Diese ist in der That in Ansehung ihres Zwecks u. Plans eine Art von Räthsel, von dem es mehrere Auflösungen geben kann u. mehrere versucht worden sind. Die Erhardische hat viel für sich, u. könnte, ganz ausgeführt, leicht mehr leisten, als das Buch des Morgenstern, das Sie ja selbst besitzen. So gut ich aber mit diesem Aufsatz zufrieden bin (da das, was ich vermisse, nur darum fehlt, weil er Fragment ist) so wenig kann ich es mit Erhards Rec. der Fichtischen Vorlesungen seyn. Nie hätte ich mir einfallen lassen, daß er der Vf. derselben wäre. Denn wenn ich auch annehmen könnte, daß die offenbaren Sprachfehler, mit denen sie gleich anhebt, bloße Druckfehler wären, so ist die Vergleichung mit Raphael, die Aufwerfung der Fragen, vorzüglich die Verschiebung ihrer Antworten, u. der Auszug selbst, alles von der Art, daß ich nicht einmal einen gewöhnlich guten philosophischen Kopf vermuthet hätte. In dem Auszuge vermisse ich z. B. ganz, daß die wesentlichen Dinge recht herausgestellt, u. durch die Stellung selbst gewürdigt wären, was doch unumgänglich nöthig ist, wenn der Leser einen wahren Begriff von einer philosophischen Schrift bekommen soll. Vermuthlich aber hat E. die Anzeige nicht abschlagen, u. doch auch hier seine wahre Meynung nicht äußern wollen. Daher mag Aengstlichkeit u. Verdrießlichkeit gekommen seyn. Die der Beyträge las ich noch nicht.
Schlegels Arbeit in beiden Heften hat mich wieder sehr interessirt, besonders der Ugolino, mit dessen Geschichte ich noch wenig bekannt war. Indeß profezeihe |sic| ich ihm kein sonderliches Glück. Die übersetzte Stelle dürfte man doch u. ich weiß nicht ob mit Unrecht, mehr gräßlich als schön u. erhaben finden, und sein Raisonnement ist mir ein wenig zu gedehnt vorgekommen. In der Note zum Tydeus u. Menalippus |sic| hat sich Schlegel wohl geirrt. Dante dachte vermuthlich an eine Mythe, die mir immer sehr merkwürdig gewesen ist. Tydeus verschlang nemlich vor Theben das Gehirn eines erschlagenen Feindes, u. Minerva, die ihn vorher hatte unsterblich machen wollen, überließ ihn nun wegen dieser Barbarei seiner Sterblichkeit.
Der Diebstahl hat doch noch meine Erwartungen übertroffen. Anfangs ist zwar das Fräulein wieder ziemlich grob, u. das Gespräch sehr schleppend. Aber die Geschichte hält sich doch leidlich, u. gewinnt durch das psychologische Interesse, das sie erregt. Mich soll wundern, wie er die Folge gewendet hat.
In Voß Dichtkunst sind mir die Härten des Inhalts u. der Sprache mehr im Druck, als sonst im Mscrpt. aufgefallen. Ich habe neuerlich einige Gesänge seiner neuen Odyssee mit prüfender Aufmerksamkeit auf die Sprachneuerungen durchgelesen. Es ist wirklich kein Capitel der Grammatik, aus dem man nicht, wenn man den gewöhnlichen Gebrauch zur Regel nimmt, eine Menge Soloecismen sammeln könnte. Auch gegen die Prosodie kommen starke Dinge vor, u. ich kann es nicht läugnen, daß ich das große Ansehn, in dem er jetzt wirklich bei vielen steht, für verderblich halte. Da es gewiß sogar nothwendig ist die Sprache zu verbessern, aber gewiß nicht gut, in dem Neuern keine Grenze zu finden, so habe ich jetzt viel, indeß noch ohne großen Erfolg, über die Auffindung dieser Grenzen nachgedacht. Viel, glaube ich, kommt darauf an, nicht alles für Verbesserung zu halten, was an sich in einer Sprache überhaupt ein Vorzug ist, sondern sehr genau auf die Eigenthümlichkeit der besondern Sprache selbst zu sehen. Nicht bloß daß die Sprache selbst ein organisches Ganze ist, so hängt sie auch mit der Individualität derer, die sie sprechen, so genau zusammen, daß dieser Zusammenhang schlechterdings nicht vernachlässigt werden darf. Darum dünkt mich, sollte niemand so sparsam mit Sprachverbesserungen seyn, als gerade der Uebersetzer, da dieser seine Sprache nicht einmal nach einem allgemeinen Ideal, sondern noch dazu nach einer bestimmten andern Sprache umändert. Um aber freilich hier nur irgend feste Regeln zu bestimmen, müßte es möglich seyn, die Eigenthümlichkeiten einer bestimmten Sprache genau charakteristisch, u. zugleich so ausführlich anzugeben, daß es möglich wäre, danach einzelne empirische Regeln für die Sprachverbesserung herzuleiten, u. hiezu sehe ich noch das Mittel nicht ein. Bis dahin aber werden immer beide, die für u. wider Voß streiten bald beide Recht, bald beide Unrecht haben.
Von wem ist der Kirchhof u. Lethe? Letzteres hat mir nicht recht gefallen wollen, das erstere mehr, wenn ich auch schon die Gattung nicht liebe.
Aber Sie werden Sich gewundert haben, daß ich noch nicht früher des Jacobischen Aufsatzes gedachte. Sehr richtig sagen Sie, daß nichts charakteristischer seyn kann. Ideen, Sprache, die guten wie die geschmacklosen Stellen – alles Er u. nur Er. Auch hat ihn hier jedermann, soviel ich hörte, erkannt, u. mit Vergnügen gelesen. Mir liegt die saure Mühe, die ich mit dem Woldemar gehabt, noch zu sehr im Gedächtniß, als daß ich nicht von dieser Art Compositionen ein wenig abgeschreckt seyn sollte.[a] Unläugbar sind die Haupt-
Fußnoten
- a |Editor| Bei der Ausgabe des Woldemar wird es sich um die von Humboldt rezensierte Ausgabe Königsberg 1794 handeln: Allgemeine Literaturzeitung vom Jahre 1794, Band 3, Nr. 315, Sp. 801–807; Nr. 316, Sp. 809–816; Nr. 317, Sp. 817–821 (= GS I 288–310). Da die gedruckte Rezension sehr positiv ist, verwundert der kritische Ton Humboldts an dieser Stelle. [FZ]