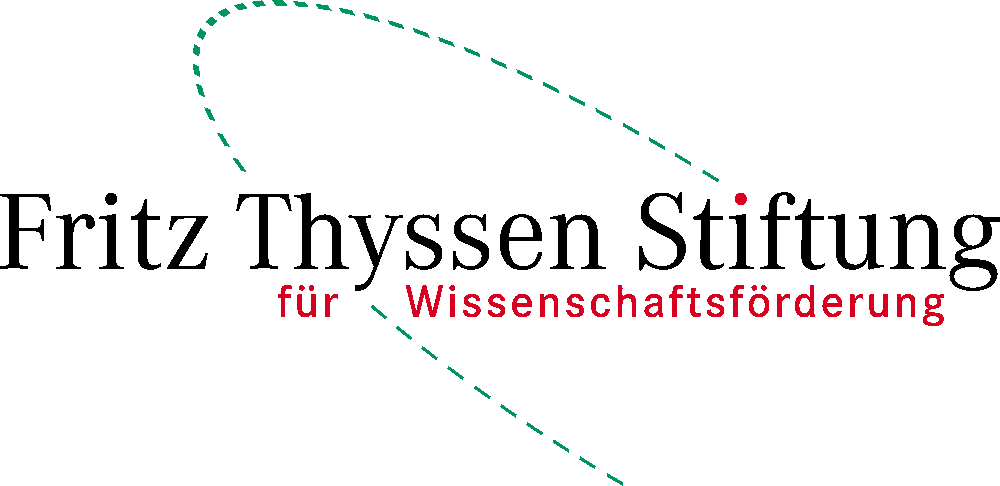Alexander von Humboldt an Wilhelm von Humboldt, 25.11.1802
Lima, d. 25. November 1802.Aus meinen vorigen Briefen, lieber Bruder, musst Du meine Ankunft in Quito wissen. Unser Weg dahin ging (im September 1801) durch die Schneegegenden von Quiridiu und Tolima. Denn die Cordillere der Anden bildet drei abgesonderte Arme; und da wir zu Sta. Fé de Bogota uns auf dem östlichsten derselben befanden, so mussten wir nun den höchsten dieser Gebirgsarme übersteigen, um an die Küsten des Südmeeres zu gelangen. Blos Ochsen lassen sich auf diesem Wege gebrauchen, um das Gepäcke fortzuschaffen. Die Reisenden selbst pflegen durch Männer getragen zu werden, welche Cargueros heissen. Sie haben auf ihren Rücken einen Stuhl gebunden, worauf der Reisende sitzt; machen 3 bis 4 Stunden Wegs den Tag über und verdienen in 5 bis 6 Wochen nur 14 Piaster. Wir zogen die Fusswanderung vor und da das Wetter ungemein schön war, so brachten wir nur 17 Tage in diesen Einöden zu, woselbst keine Spur sich findet, dass sie je bewohnt gewesen wären, und wo man in Hütten von Heliconia-Blättern schläft, die man zu dem Ende mit sich nimmt. Am westlichen Abhange der Anden gibt es Sümpfe, worein man bis an die Knie sinkt. Das Wetter hatte sich geändert, es regnete stromweise in den letzten Tagen, unsere Stiefeln faulten uns am Leibe, und wir kamen mit nackten und blutrünstigen Füssen zu Cartago an, aber mit einer schönen Sammlung neuer Pflanzen bereichert, wovon ich eine Menge Zeichnungen mitbringe.
Von Cartago gingen wir nach Popayan, über Buga durch das herrliche Thal des Caucaflusses, wobei wir das Chocagebirge mit seinen Platinagruben immer zur rechten Seite hatten.
Den November 1801 blieben wir zu Popayan und besuchten von dort die Basaltgebirge von Julusuito; den Schlund des Vulkans von Purace, der mit entsetzlichem Getöse Dämpfe eines durch geschwefeltes Wasserstoffgas geschwängerten Wassers ausstösst; und die porphyrartigen Granite von Pisché, welche fünf- bis siebeneckige Säulen bilden, denjenigen gleich, die ich mich in den Euganeen in Italien gesehen zu haben erinnere, und die Strange[a] beschrieben hat. Die grösste Schwierigkeit stand uns noch zu überwinden bevor, zwischen Popayan und Quito. Auf diesem Wege mussten wir die Paramos von Pasto übersteigen, und zwar in der Regenzeit, die bereits angefangen hatte. Paramo heisst in den Anden jeder Ort, wo auf einer Höhe von 1700 bis 2000 Toisen die Vegetation still steht, und eine Kälte ist, die bis in die Knochen dringt. Um die Hitze des Patiathales zu vermeiden, wo man in Einer Nacht Fieber bekommt, die drei bis vier Monate dauern und die unter den Namen calenturas de Patia bekannt sind, gingen wir über die Spitze der Cordillere, wo scheusslich schroffe Abgründe sind, kamen so von Popayan nach Almager und von da nach Pasto, das am Fusse eines furchtbaren Vulkans liegt.
Man kann sich nichts Schrecklicheres denken, als den Eintritts- und den Eingangsweg bei dieser kleinen Stadt, wo wir die Weihnachten zubrachten, und deren Einwohner uns mit rührender Gastfreundlichkeit aufnahmen. Dicke Wälder liegen zwischen Morästen; die Maulthiere sinken bis auf den halben Leib ein; und man muss durch so tiefe und enge Schlüfte, dass man in Stollen eines Bergwerks zu kommen glaubt. Auch sind die Wege mit den Knochen der Maulthiere gepflastert, die hier vor Kälte oder aus Mattigkeit umfielen. Die ganze Provinz Pasto mit Inbegriff der Gegenden um Guachucal und um Tuqueres, ist eine gefrorne Gebirgsfläche, fast über den Punkt herauf wo die Vegetation aushalten kann, und mit Vulkanen und Solfataren umringt, woraus beständige Rauchwirbel dampfen. Die unglücklichen Bewohner dieser Wüsteneien haben keine andere Nahrung als Pataten; und wenn diese ihnen fehlen, wie im letztverwichenen Jahr, so gehn sie ins Gebirge, um den Stamm eines kleinen Baumes zu essen, der Achupalla heisst (Pourretia Pitcarnia). Da aber der nemliche Baum auch den Bären der Andes zur Speise dient, so machen diese ihnen oft die einzige Nahrung streitig, welche dies hohe Land den Menschen darbeut. Zur Nordseite des Vulkans von Pasto habe ich in dem kleinen indianischen Dorf Voisako, 1370 Toisen über der Meeresfläche, einen rothen Thon und einen Hornstein-Porphyr mit eingemengtem glasigen Feldspath entdeckt, welcher alle Eigenschaften des Serpentins vom Fichtelgebirge besitzt. Dieser Porphyr zeigt sehr deutliche Pole, aber durchaus keine Anziehung. Nachdem wir zwei Monate hindurch Tag und Nacht von Regengüssen durchnässt waren und bei der Stadt Ibarra beinahe ertranken, da plötzlich bei einem Erdbeben das Wasser stieg; langten wir am 6. Jänner 1802 zu Quito an, wo der Marques von Selvalegre die Güte gehabt hatte, uns ein vortreffliches Haus einzurichten, das nach so vielen Beschwerden uns alle Gemächlichkeiten darbot, die man nur in Paris oder London verlangen könnte.
Die Stadt Quito ist schön, aber der Himmel traurig und neblicht; die benachbarten Berge zeigen kein Grün, und die Kälte ist beträchtlich. Das grosse Erdbeben vom 4. Februar 1797, welches die ganze Provinz umwarf und in Einem Augenblick 35 bis 40000 Menschen tödtete, ist auch in jener Rücksicht den Bewohnern höchst schädlich gewesen. Es hat die Temperatur der Luft so sehr geändert, dass der Thermometer gewöhnlich zwischen 4 und 10 Grad Réaumur steht, und selten auf 16 oder 17 steigt, da Bouguer ihn beständig auf 15 oder 16 sah. Seit jener Katastrophe hören die Erdbeben nicht auf; und welche Stösse mitunter! Wahrscheinlich ist der ganze hohe Theil der Provinz ein einziger Vulkan. Was man die Berge von Kotopaxi und Pichincha nennt, sind nur kleine Spitzen, deren Krater verschiedene Röhren bilden, die sämmtlich zu dem nämlichen Heerd hinabführen. Diese Hypothese ist leider nur zu sehr durch das Erdbeben von 1797 erwiesen. Denn die Erde hat sich allenthalben damals von einander gethan, und Schwefel, Wasser u. s. w. ausgeworfen. Ungeachtet dieser Schrecknisse und Gefahren, womit die Natur sie rings her umgibt, sind die Einwohner von Quito froh, lebendig und liebenswürdig. Ihre Stadt athmet nur Wollust und Ueppigkeit und nirgend vielleicht gibt es einen entschiedenern und allgemeinern Hang sich zu vergnügen. So kann sich der Mensch gewöhnen, ruhig am Rande eines jähen Abgrundes zu schlafen.
Wir haben uns fast acht Monate in der Provinz Quito aufgehalten, von Anfang des Jänners bis in den August. Diese Zeit ward angewandt, jeden der dortigen Vulkane zu besteigen. Wir untersuchten nacheinander die Spitzen des Pichincha, Cotopaxi, Antisana und Iliniça; brachten 14 Tage bis 3 Wochen bei jeder zu, kehrten in der Zwischenzeit immer nach der Hauptstadt zurück und brachen am 9. Juni 1802 von da auf, um nach dem Chimboraço zu reisen, der im südlichen Theile dieser Provinz liegt.
Zweimal, den 26. und den 28. Mai 1802, bin ich bei dem Krater des Pichincha gewesen, des Berges, welcher neben der Stadt Quito emporragt. Niemand, so viel man weiss, hatte ihn bisher je gesehen, ausser Condamine; und dieser selbst kam nur hin, nachdem er 5 bis 6 Tage in unnützem Suchen verloren hatte, kam ohne Instrumente hin, und konnte wegen der übermässigen Kälte nur 12 bis 15 Minuten dort oben aushalten. Es glückte mir, meine Instrumente hinzubringen, ich traf die nöthigen Vorkehrungen, um das Wichtigste dort zu untersuchen und habe Luft dort gefangen, die ich analysirte. Meine erste Reise machte ich allein mit einem Indianer. Da Condamine sich dem Krater von der niedern mit Schnee bedeckten Seite des Randes genähert hatte, so trat ich bei meinem ersten Versuch in seine Fussstapfen. Aber bald wären wir verunglückt. Der Indianer sank bis an die Brust in eine Spalte und wir sahen mit Grausen, dass wir über eine Brücke von eisigem Schnee gegangen waren. Denn wenig Schritte von uns gab es Löcher, wodurch das Tageslicht schien. So befanden wir uns, ohne es zu wissen, auf Gewölben, die mit dem Krater selbst zusammen hingen. Erschreckt, aber nicht muthlos, fasste ich einen andern Entschluss. Aus dem Umkreise des Kraters springen, gleichsam über den Abgrund hinstrebend drei Felsspitzen hervor, die nicht mit Schnee bedeckt sind, weil die Dämpfe aus dem Schlunde des Vulkans ihn unaufhörlich schmelzen. Auf einen dieser Piks stieg ich, und fand auf dessen Gipfel einen Stein, der nur von einer Seite auflag und unten minirt war, so dass er einen Balkon über den Abgrund bildete. Hier schlug ich meinen Sitz auf, um unsere Versuche anzustellen. Aber dieser Stein ist nur ungefähr 12 Fuss lang und 6 Fuss breit, und wird von den häufigen Erdstössen mächtig erschüttert, deren wir 18 in nicht vollen 30 Minuten zählten. Um den Boden des Kraters besser zu beobachten, legten wir uns auf den Bauch; und ich glaube nicht, dass die Fantasie sich etwas Finstereres, Trauer- und Todmässigeres vorstellen kann, als wir hier sahen. Der Schlund des Vulkans bildet ein kreisformiges Loch, ungefähr von 1 Französ. Meile im Umfang; die Ränder desselben, in Pikgestalt ausgehauen, sind oberwärts mit Schnee bedeckt; das Innere ist dunkelschwarz. Aber die Tiefe ist so ungeheuer, dass mehrere Berge darin stehen, deren Gipfel man unterscheidet. Ihre Spitzen schienen 300 Toisen unter uns; wo also mag ihr Fuss stehen? Ich zweifle nicht, dass der Boden des Kraters mit der Stadt Quito horizontal liegt. La Condamine fand diesen Krater erloschen und sogar mit Schnee überdeckt; wir aber haben den Einwohnern von Quito die traurige Nachricht bringen müssen, dass es in ihrem nachbarlichen Vulkan jetzt brennt. Deutliche Zeichen gestatteten keinen Zweifel hieran. Schwefeldämpfe erstickten uns beinahe, wenn wir uns dem Schlunde näherten; wir sahen selbst bläuliche Flammen hin und her hüpfen und fühlten alle 2 oder 3 Minuten heftige Stösse von Erdbeben, welche die Ränder des Kraters erschüttern, aber 100 Toisen entfernt nicht mehr zu spüren sind. Vermuthlich hat die grosse Katastrophe vom Februar 1797 auch das Feuer des Pichincha wieder angezündet. – Zwei Tage nach diesem Besuch bestieg ich den Berg noch einmal, in Begleitung meines Freundes Bonpland und Karls von Montufar, eines Sohnes des Marques Selvalegre. Wir führten noch mehr Instrumente bei uns, als das erste Mal, und massen den Umfang des Kraters und die Höhe des Berges. Den ersten fanden wir von 754, die andere von 2477 Toisen. Während der zwei Tage zwischen unsern zwei Besuchen des Pichincha, hatten wir ein sehr starkes Erdbeben zu Quito. Die Indianer schrieben es den Pulvern zu, die ich in den Vulkan geworfen haben sollte.
Bei unsrer Reise zum Vulkan von Antisana begünstigte uns die Witterung so, dass wir bis zu 2773 Toisen hinaufstiegen. Der Barometer sank in dieser hohen Gegend auf 14 Zoll 11 Linien und die geringe Dichtigkeit der Luft trieb uns das Blut aus den Lippen, dem Zahnfleisch und selbst den Augen. Wir fühlten uns äusserst matt, und einer unsrer Begleiter fiel in Ohnmacht. Auch hatte man es für unmöglich gehalten, weiter als an die Spitze, el coraçon genannt, zu kommen, welche Condamine erstieg, und die 2470 Toisen hoch liegt. Die Analyse der von unserm höchsten Standpunkt zurückgebrachten Luft gab 0,008 Kohlensäure auf 0,218 Sauerstoffgas.
Den Vulkan von Cotopaxi besuchten wir gleichfalls, aber es war uns unmöglich, an den Schlund des Kraters zu gelangen. Es ist falsch, dass dieser Berg durch das Erdbeben vom J. 1797 niedriger geworden sei.
Am 9. Juni traten wir die Reise zum Untersuchen und Messen des Chimborazo und des Tunguragua an, und zum Aufnehmen aller durch die grosse erwähnte Katastrophe zerrütteten Länder. Es gelang, bis auf 250 Toisen nah uns dem Gipfel des ungeheuren Kolosses Chimborazo zu nähern. Ein Zug vulkanischer, schneeloser Berge erleichterte uns das Steigen. Wir kamen auf 3031 Toisen und fühlten die nemliche Beschwerde wie auf der Spitze des Antisana. Selbst noch ein paar Tage nach unsrer Rückkehr in die Ebene blieb uns ein Uebelbefinden, das wir nur der Wirkung der Luft (in jener Höhe) zuschreiben konnten, deren Analyse uns 20 Hunderttheile Sauerstoff gab. Die uns begleitenden Indianer hatten uns schon früher verlassen, und sagten, dass wir sie tödten wollten. Wir blieben also allein, Bonpland, Karl Montufar, ich, und einer meiner Bedienten, der einen Theil meiner Instrumente trug. Dennoch hätten wir unsern Weg bis zu dem Gipfel fortgesetzt, wenn nicht ein zu grosser Spalt im Boden uns gehindert hätte. Auch thaten wir sehr wohl, umzukehren. Auf unserm Rückwege fiel ein so starker Schnee, dass wir uns kaum sehen konnten. Wir hatten uns gegen die schneidende Kälte dieser hohen Gegend nur wenig geschützt und litten daher unsäglich, vornehmlich ich, der ich noch einen wunden Fuss von einem Fall vor wenig Tagen hatte, welches mir die grössten Schmerzen verursachte, da man auf diesem Wege alle Augenblick an einen spitzen Stein stiess und nicht vorsichtig genug gehen konnte. La Condamine hat den Chimborazo an 3217 Toisen hoch gefunden. Meine, zweimal angestellte, trigonometrische Messung gab mir 3267; und ich darf meinen Operationen etwas trauen. Dieser ganze erstaunenswürdige Riesenberg besteht, wie alle hohen Berge der Anden, nicht aus Granit, sondern vom Fuss bis zum Gipfel aus Porphyr, und der Porphyr hat 1900 Toisen Dicke. Der kurze Aufenthalt in dieser ungeheuren Höhe, wozu wir uns hinaufgeschwungen hatten, zeigte die traurigsten Schreckbilder. Ein Winternebel umhüllte uns, woraus nur von Zeit zu Zeit die grauenvollsten Abgründe in unserer Nähe hervorschimmerten. Kein beseeltes Wesen, nicht einmal der Condor, der auf dem Antisana stets über unsern Häuptern schwebte, gab der Luft ein Leben. Kleine Moose waren die einzigen organischen Gestalten, die uns erinnerten, dass wir noch der bewohnten Erde angehörten.
Fast mit Wahrscheinlichkeit lässt sich annehmen, dass der Chimborazo, wie der Pichincha und der Antisana vulkanischer Natur ist. Die Bergreihe, auf welcher wir zu ihm hinaufstiegen, besteht aus einem verbrannten und verschlackten Felsen, mit Bimstein gemischt; sie gleicht allen Lavaströmen dieses Landes, und geht noch über den Punkt, wo wir innezuhalten genöthigt wurden, hinauf zur Spitze des Berges. Es ist möglich, es ist selbst wahrscheinlich, dass diese Spitze der Krater eines erloschenen Vulkans sei. Aber der Gedanke blos dieser Möglichkeit erregt ein gerechtes Schaudern. Denn, wenn dieser Vulkan sich wieder entzündete, so müsste ein solcher Koloss die ganze Provinz vernichten.
Der Berg Tunguragua hat seit dem Erdbeben 1797 an Höhe verloren. Bouguer gibt ihm 2650 Toisen, ich fand nur 2530. Folglich hat er über 100 T. eingebüsst. Auch versichern die Einwohner, vor ihren Augen seine Spitze durch die Erschütterung niederstürzen gesehen zu haben.
* * *
Zu Riobamba (südwärts von Quito, auf dem Wege nach Lima) brachten wir einige Wochen zu, bei einem Bruder Karls von Montufar unseres Reisegefährten, welcher daselbst Corregidor ist. Hier verschaffte uns das Ungefähr eine höchst merkwürdige Entdeckung. Der Zustand der Provinz Quito, ehe der Inka Tupayupangi sie eroberte, ist noch durchaus unbekannt. Aber der indianische König, Leandro Zapla[b], welcher zu Likan wohnt und für einen Indianer ungemein gebildet ist, besitzt Handschriften von einem seiner Vorfahren aus dem 16. Jahrhundert verfasst, welche die Geschichte jener Begebenheiten enthalten. Sie sind in der Puruguay-Sprache geschrieben. Dies war ehedem die allgemeine Sprache in Quito, die nachher der Inka- oder Quichua-Sprache gewichen und jetzt völlig untergegangen ist. Glücklicherweise fand ein anderer Ahnherr Zapla’s Vergnügen daran, diese Memoiren in’s Spanische zu übersetzen. Wir haben aus ihnen schätzbare Nachrichten geschöpft: vornehmlich über die merkwürdige Epoche der Erupzion des sogenannten Nevado del Altar, welches der grösste Berg der Welt gewesen sein muss, höher als der Chimborazo und der bei den Indianern Kapaurku (Haupt der Berge) hiess. Zu der Zeit regierte Uainia Abomatha, der letzte unabhängige Kochokando des Landes, zu Likan. Die Priester offenbarten ihm die unglückschwangere Bedeutung dieser Katastrophe. "Der Erdball, sagten sie, verändert seine Gestalt; andere Götter werden kommen und die unsrigen vertreiben. Lass uns dem Geheiss des Schicksals nicht widerstreben." Wirklich führten die Peruaner den Sonnendienst (statt der alten Religion) ein. Der Ausbruch des Vulkans dauerte 7 Jahre, und die Handschrift Zapla’s lässt die Asche zu Likan so dicht und häufig regnen, dass eine siebenjährige stete Nacht dort gewesen sei. Wenn man in der Ebene von Tapia die Menge der vulkanischen Materie, um den ungeheuren damals eingestürzten Berg (itzt steht er, wie zerrissen mit zwei noch immer mächtig hohen Spitzen da) betrachtet; wenn man bedenkt, dass der Cotopoxi mehrmal Quito in 15–18stündige Finsterniss eingehüllt hat, so muss man einräumen, dass die Uebertreibung wenigstens nicht gar zu unmässig war.
Dieses Manuscript, und die Sagen die ich in Parima sammelte, und die Hieroglyphen, die ich in der Wüste des Casiquiari sah, wo gegenwärtig keine Spur von Menschen zu finden ist: Alles dies, nebst Clavigero’s Nachrichten über die Wanderungen der Mexikaner in das südliche Amerika hat mich auf Ideen über den Ursprung dieser Völker geleitet, die ich zu entwickeln gedenke, sobald mir Musse dazu wird.
Das Studium der amerikanischen Sprachen hat mich ebenfalls sehr beschäftigt, und ich habe gefunden, wie falsch La Condamine’s Urtheil über ihre Armuth ist. Die Caribische Sprache z. B. verbindet Reichthum, Anmuth, Kraft und Zartheit. Es fehlt ihr nicht an Ausdrücken für abstrakte Begriffe: sie kann von Zukunft, Ewigkeit, Existenz u. s. w. reden; und hat Zahlwörter genug, um alle mögliche Combinationen unsrer Zahlzeichen anzugeben. Vorzüglich lege ich mich auf die Inka-Sprache; sie ist die gewöhnliche hier (zu Quito, Lima u. s. w.) in der Gesellschaft, und ist so reich an feinen und manichfachen Wendungen, dass die jungen Herren, um den Damen Süssigkeiten vorzusagen, gemeiniglich Inka zu sprechen anfangen, wenn sie den ganzen Schatz des Kastilischen erschöpft haben.
Diese zwei Sprachen, und einige andere gleich reiche, könnten allein genügen, sich zu überzeugen, dass Amerika einst eine weit höhere Kultur besass, als die Spanier 1492 dort fanden. Aber ich habe dafür noch ganz andere Beweise. Nicht blos in Mexico und Peru, sondern auch am Hofe des Königs von Bogota (ein Land, dessen Geschichte man in Europa gar nicht kennt, und dessen Mythologie und fabelhafte Sagen selbst schon höchst interessant sind), verstanden die Priester eine Mittagslinie zu ziehen, und den Augenblick des Solstitiums zu beobachten; sie verwandelten das Mondjahr in ein Sonnenjahr, durch Einschaltungen: und ich besitze einen siebeneckigen Stein, der zu Sta. Fé gefunden ist und der ihnen zur Berechnung dieser Schalttage diente. Noch mehr! zu Erivaro im Innern der Landschaft Parima glauben die Wilden, dass der Mond bewohnt ist, und wissen durch Tradition von ihren Vätern, dass er sein Licht von der Sonne hat.
Von Riobamba ging mein Weg über den berühmten Paramo des Assuay nach Cuença. Doch besuchte ich vorher das grosse Schwefelwerk zu Tiskan. Diesen Schwefelberg wollten die rebellirenden Indianer, nach dem Erdbeben von 1797, in Brand stecken. Gewiss der schrecklichste Plan, den je die Verzweiflung eingab! denn sie hofften auf die Art einen Vulkan hervorzubringen, der die ganze Provinz Alaussi vernichtet hätte.
Auf dem Paramo von Assuay, in einer Höhe von 2300 Toisen, sind die Ruinen des prächtigen Inka-Weges. Diese Strasse läuft fast bis nach Kusko, ist ganz aus behauenen Steinen aufgeführt und schnurgerade: sie gleicht den schönsten Wegen der alten Römer. In derselben Gegend liegen auch die Ruinen des Palastes des Inka Tupayupangi, welche La Condamine in den Memoiren der Berliner Akademie beschrieben hat. Man sieht annoch in dem Felsbruch, welcher die Steine dazu geliefert hat, mehrere halbbearbeitete. Ich weiss nicht, ob Condamine auch von dem sogenannten Billard des Inka spricht. Die Indianer nennen den Platz in der Quichuasprache Inka-chungana (des Inka Spiel); allein ich zweifle, dass er diese Bestimmung hatte. Es ist ein Kanapé, in den Felsen gehauen, mit Arabesken-ähnlichen Zieraten, worin, wie man glaubt, die Kugel lief. Unsere englischen Gärten haben nichts Eleganteres aufzuweisen. Der richtige Geschmack des Inka leuchtet überall hervor; der Sitz ist so gestellt, dass man eine entzückende Aussicht geniesst. Nicht weit von da, in einem Gehölz findet man einen runden Fleck gelben Eisens in Sandstein. Die Peruaner haben die Platte mit Figuren geziert: denn sie glaubten, dass sie die Sonne abbilde. Ich habe eine Zeichnung davon genommen. Wir blieben nur 10 Tage zu Cuença und begaben uns von da nach Lima, durch die Provinz Jaen, wo wir in der Nähe des Amazonenflusses einen Monat zubrachten. In Lima kamen wir den 23. October 1802 an.
Ich gedenke von hier im Dezember nach Acapulco, und von da nach Mexico zu gehen, um im Mai 1803 in Havana zu sein. Da werde ich mich ohne Verweilen nach Spanien einschiffen. – Ich habe, wie Du siehst, den Gedanken aufgegeben, über die Philippinen zurückzukehren. Ich hätte eine ungeheuere Seereise gemacht, ohne etwas anderes zu sehen, als Manilla und das Cap; oder hätte ich Ostindien besuchen wollen, so würde es mir an dem, was ich zu dieser Reise brauchte, gefehlt haben, da ich es mir hier nicht verschaffen kann.
Fußnoten
- a |Editor| Von John Strange erschien 1778 in Mailand: De’ monti colonnari e d’altri fenomeni vulcanici dello Stato Veneto Memoria, bereits 1780 in deutscher Übersetzung in Heidelberg bei Pfähler: Johann Strange, Baronet und Residenten Sr. Großbrittan. Majestät, bey der erlauchten Rep. Venedig … Abhandlung von den säulenartigen Gebürgen und andern vulkanischen Naturerscheinungen im venetianischen Gebiete: in einem Schreiben an Herrn Baronet Pringle, etc.; mit Kupfern.
- b |Editor| Gemeint ist hier Leandro Sepla y Oro.