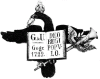 |
Tabellarische Übersichten zum Vergleich von
literarischen Vorlagen (›Lehrbüchern‹) und dem Konzept (›Ms Holstein‹) zur Vorlesung (1757/59) |
| [Plinus] | [1. Lulofs] | [2.1 Tiere] | [2.2 Pflanzen] | [2.3 Steine] | [3. Erdteile] | [Übersicht] |
Tabelle I: Kant // Plinius
| Kant: Physische Geographie | Plinius: naturalis historia |
|---|---|
| Vorbereitung | 1. Buch [nicht adäquat] |
| 1. Teil: physische Geographie | 2. Buch |
| 2. Teil: Naturgeschichte [0. Allgemeines]
(1) Mensch / (2) Tiere / (3) Pflanzen / (4) Mineralien |
3. - 6. Buch
(1) Europa, (2) Asien, (3) Afrika |
| 3. Teil: Geographie (1) Asien, (2) Afrika, (3) Europa, (4) Amerika |
7. - 37. Buch
(1) 7. Buch / (2) 8. - 11. Buch / (3) 12. - 32. Buch / (4) 33. - 37. Buch |
Kant hat gegenüber Plinius (ob bewußt, sei dahingestellt!) genau eine große Verschiebung vorgenommen: Die Geographie incl. Ethnographie rückt an die letzte, die dritte Stelle. Zudem wird die Abfolge der drei Teile der Alten Welt geändert und die Neue Welt ›Amerika‹ hinzugefügt.
Allerdings haben die bei Plinius der Medizin in weiterem Sinn gewidmeten Bücher (20 - 32) bei Kant kein adäquates Gegenstück; allenfalls zwei kurze Passagen in der Abhandlung des Reiches der Pflanzen (p. 202. / p. 209f.) und eine Bemerkung zur ›terra sigillata‹ (p. 225) können hierfür in Anspruch genommen werden. Ein unmittelbarer Bezug auf Plinius ist - so weit sich ermitteln ließ - nur im Bereich der noch nicht so genannten ›Anthropologie‹ gegeben. Zu Beginn des Tierreiches wird der Mensch abgehandelt. Im Ms Holstein heißt es p. 122:
| »Plinii einäugigte, höckerigte, einfüssige Menschen, Leute ohne Maul, Zwerge gehören auch dahin.« |
Tabelle II: Kant // Lulofs
(Teil 1 der Vorlesung: physische Geographie)
| Ms Kaehler (1775 ?)
5 Artikel |
Ms Holstein (1757/59)
9 Hauptstück(e) |
Lulofs (1755): I. Teil
20 Hauptstück(e) |
|---|---|---|
| Prolegomena | Vorbereitung | 1. Gestalt der Erdkugel 2. Größe der Erde 3. Jährliche und tägliche Bewegung [ |
| 1. Vom Waßer | 1. Geschichte des Meeres | 12. Die See und ihre Eigenschaften 13. Ebbe und Fluth 14. Die übrigen Bewegungen der See |
| 2. Vom Lande | 2. Geschichte des festen Landes und der Inseln 3. [Erdbeben und feuerspeiende Berge] 4. Geschichte der Quellen und Brunnen 5. Geschichte der Flüße |
5. Das feste Land und desselben allgemeiner Abtheilung 6. Inseln und Halbinseln 7. Berge überhaupt 8. Stellung und Zusammenordnung 9. Höhe der Berge 10. Berge inwendig betrachtet 11. Brennende und feuerspeiende Berge 15. Seen und Sümpfe 16. Brunnen 17. Flüsse |
| 3. Vom Luftkreise | 6. Geschichte des Luftkreises 7. Von dem Zusammenhang der Witterung mit den Jahreszeiten |
19. Dunstkreise der Erdekugel 20. Bewegungen und Wirkungen des Dunstkreises |
| 4. Von der Geogonie, oder von der allgemeinen Geschichte der Erde | 8. Geschichte der großen Veränderungen, welche die Erde ehedem erlitten hat und noch leidet |
18. Veränderungen der Erde, vornehmlich ihrer Oberfläche |
| 5. Von der Schiffarth. | 9. Von der Schiffahrt | [Varenius 1650, Kap. 35-40] |
Der erste und namengebende Teil der Vorlesung wird im ›Ms Holstein‹ in neun Hauptstücke gegliedert. In der Programmschrift des Jahres 1757 waren es nur acht. Titellos eingeschoben ist die Nr. 3, die inhaltlich im 11ten Haupstück bei Lulofs (1755) vorgebildet ist. Das Werk von Lulofs zerfällt in zwei Teile, einen zuerst abgehandelten ›physikalischen‹ und einen zweiten ›mathematischen‹. Sichtlich hat Kant den Stoff aus dem physikalischen Teil bezogen. Er zeigt sich zudem bemüht, die Struktur zu vereinfachen, was offenbar erst in der Vorlesung befriedigend gelungen ist, über die das ›Ms Kaehler‹ die früheste Auskunft gibt: Das Schema der vier Alten Elemente umschreibt den abzuhandelnden Stoff vollständig. Die Schiffahrt ist ein ›neuzeitlicher‹ Anhang in der Nachfolge zu Varenius 1650 [Gliederbau].
Für einer detaillierten Vergleich des ersten Teil in den Texten: 1757/59 bis 1792: Typen A bis D.
Tabelle III: Tierreich
Halle // Kant
(Teil 2 der Vorlesung: ›Naturgeschichte‹)
| Abhandlung des Tierreiches nach Halle (1757) | Halle, S. |
Ms Holstein, p. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Landtiere | 1. Abschnitt: Mensch | 117ff. | 114ff. | ||||
| 2. Abschnitt: Vierfüssige Landtiere | 204ff. | 133ff. | |||||
| a) lebend gebärende | |||||||
| A. Mit Klauen (1. Hauptstück) | 229ff. | 133ff. | |||||
| B. Mit Zehen: in sechs Ordnungen (2. Hauptstück) | 383-604 | 147ff. | |||||
| b) eierlegende (Amphibien) | -- | 167ff. | |||||
| 2. Seetiere (Wasser): Fische & Schalentiere | -- | 168ff. | |||||
| 3. Insekten & Kriechtiere (Feuer) | -- | 183ff. | |||||
| 4. Vögel (Luft) | [Halle 1760] | 191-195 | |||||
Zur Abhandlung der ›Seetiere‹ wird zusätzlich auf verschiedene Einzelpublikationen zurückgegriffen. Für die ›Insekten‹ wird keinerlei vorgegebenes Schema befolgt; der Blick gilt der Nützlichkeit für den Menschen; in der Durchführung zeigt sich eine Orientierung an geographischen Gesichtspunkten. Bei den ›Vögeln‹ wird das ›Merkwürdige‹ betont und die Beispiele werden in geographischer Ordnung arrangiert.
Tabelle IV: Pflanzenreich
(Teil 2 der Vorlesung: ›Naturgeschichte‹)
| Abhandlung des Pflanzenreiches | ohne Lehrbuch | Ms Holstein, p. |
|---|---|---|
| Bäume | -- | 195ff. |
| Gewächse | -- | 206-212 |
Im gesamten Bereich der Pflanzen ist keinerlei geographische Ordnung - weder nach Regionen (Erdteilen) noch nach Klimazonen - erkennbar. Im Vordergrund der von Kant beschriebenen Gattungen steht eine Nutzung durch den Menschen.
Tabelle V: Steinreich
(Teil 2 der Vorlesung: ›Naturgeschichte‹)
| Abhandlung des Steinreichs nach Justi (1757) | Justi, S. |
Ms Holstein, p. |
|---|---|---|
| 1. Metalle | 11ff. | 212ff. |
| 2. Halbmetalle | 74ff. | 215ff. |
| 3. brennliche Wesen | 111ff. | 216ff. |
| 4. Salze | 134ff. | 218ff. |
| 5. Versteinerungen und figurierte Dinge | 154ff. ⇘ | 226-227 |
| 6. Steine und Erden | 193-232 ⇗ | 219-225 |
| Ursprung der Mineralien | -- | 227-228 |
Tabelle VI: Vier Erdteile
(Teil 3 der Vorlesung: ›Geographie / Ethnographie‹)
| Abhandlung der vier Erdteile | Vorlage(n) | Ms Holstein, p. |
|---|---|---|
| Asien | Salmon 1732ff., SnmR: (Gmelin 1751-52) | 228ff. |
| Afrika | Ludolf 1684-94, Colbe 1745, Salmon 1748, AHR (1749-51): Bde. 2-5 & 8. |
296ff. |
| Europa | Keyßler 1740-41; Büsching 1754. | 319ff. |
| Amerika / Eismeer | AHR (1751-59): Bde. 9, 12, 13, 16 & 17 / Müller 1758. | 330-344 |
Die Abhandlung zu Asien erfolgt in vier, nicht von ›Salmon‹ vorgegebenen Zügen; (1) Fernost: China → Indien; (2) die Inselwelt: Japan → Malediven; (3) Vorderasien: Persien → Arabien; (4) Zentralasien: ›Tatarei‹. Wobei die drei ersten Nummern je von Ost nach West gerichtet sind. Ein kurzer, beschließender Anhang ist der Nordostpassage und dem asiatischen Teil der Türkei gewidmet. Der Text stammt weit überwiegend aus einer unter dem Namen von Thomas Salmon verbreiteten insgesamt zehn Bände umfassenden Sammlung von Reisebeschreibungen: ›Die heutige Historie oder der gegenwärtige Staat von allen Nationen‹, die ausschließlich Asien abhandelt. Für ›Sibirien‹ wird auf den aktuelleren Expeditionsbericht von Johann Georg Gmelin ›Reise durch Sibirien von dem Jahr 1733 bis 1743‹ zurückgegriffen, der 1751-1752 in den Bänden 4 - 7 der in Göttingen erscheinenden Reihe ›Sammlung neuer und merkwürdiger Reisen zu Wasser und zu Lande‹ (SnmR) herausgekommen ist.
Für Afrika wird die Textgrundlage gebildet aus den Bänden 2, 3, 4, 5 und 8 der ›Allgemeinen Historie der Reisen‹ (AHR); hinzu kommen zwei klassische Einzelwerke: ein Reisebericht über die südliche Kap-Region von Peter Colb [Kolb] in einer Fassung des Jahres 1745 und lateinische Schriften (1681-1694) des Universalgelehrten Hiob Ludolf [Leut-holf] über ein christlich geprägtes Äthiopien. - Gegenstand ist nahezu ausschließlich das südlich der Wüste Sahara gelegene ›Schwarzafrika‹. Die Abhandlung folgt zunächst dem 5ten Band der AHR: Den Anfang macht der äußerste Süden, gefolgt von der Ostküste einschließlich der Insel Madagaskar (aus Bd. 8) bis zu den von mohamedanischen Arabern beherrschten Küstengegenden nördlich von Stadt und Insel Mosambik. Die Westküste wird gemäß der in den Bänden 2-4 vorgegebenen, nord-südlichen Struktur abgehandelt; je beginnend mit den vorgelagerten Inseln der Capverden und Canaren. Auch die gliedernden Überschriften des Textes haben ihre Vorlage in den Bänden der AHR. - Die am Nil gelegenen Regionen ›Aegypten‹ und ›Aethiopien‹ bilden einen weiteren Block; abschließend wird knapp die am Mittelmeer gelegene Nordküste nur genannt. Der nordwestlichen Region der ›Barbarei‹ (heute: Marokko, Algerien, Tunesien) wird (p. 318f.) kein Stoff zugeordnet.
Die zweibändige, erstmals 1754 erschienene ›Neue Erdbeschreibung‹ von Anton Friedrich Büsching liefert die Grundlage für den Abschnitt über Europa. Hinzu kommen (für Italien) einige Zusätze aus Keyßler's ›Neueste Reise durch Teutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweitz, Italien, und Lothringen‹ [...] (1740, 1741). - Allerdings ist sind Reihenfolge und Umfang gegenüber der Vorlage gravierend verändert. Büsching's erster Band behandelt mit einer bei Dänemark beginnenden Rechtsdrehung den Norden, den Osten und Südosten bis zur europäischen Türkei. Der zweite Band geht zunächst durch Südeuropa von Westen nach Osten (Portugal bis Italien); ein zweiter Schritt wendet sich dann nach Nordwesten zu den britischen Inseln. Kant hingegen bespricht zunächst den Süden von Osten nach Westen (europäische Türkei bis Portugal); die zweite Etappe ist dem Norden gewidmet (Schweden bis Rußland; die weit nordwestliche Insel Island eingeschlossen). - Im Abgleich zu Büsching fällt für den vorliegenden Text auf: (1) daß Passagen über die britischen Inseln und die zentral gelegenen Bereiche (Dänemark, Preußen, Polen) fehlen; (2) daß die Texte mehrfach kaum als zusammenfassende Exzerpte aufgefaßt werden können; sie halten eher ›zufällig‹ mancherlei Einzelheiten fest.
Der amerikanische Doppelkontinent wird nahezu ausschließlich mittels sehr kurzer Exzerpte aus der AHR präsentiert. - Die Struktur der Darstellung als solcher ist freilich erneut eigenständig: Die südliche Hälfte wird nach Art einer Rundreise dargestellt; beginnend im äußersten Süden führt der Weg die westliche Küste entlang bis Panama (Bde. 9, 12 der AHR); einige Inseln vor der Karibischen Nordostküste (Bd. 13) stiften einen Übergang zur östlichen Seite, deren Regionen von Nord nach Süd folgen. Das Material für die allerletzte, nördliche Etappe wird nahezu vollständig aus dem erst 1759 herausgekommenen Bd. 17 der AHR entnommen. Ausgeblendet bleiben Berichte über die älteren Hochkulturen von Mittel- und Südamerika, die in den Bänden 13 (Mexiko) und 15 (Peru) der AHR enthalten sind.
Tabelle VII: Übersicht
| Literarische Vorlagen (Folien) im ›Ms Holstein‹ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Teil 1: Physische Geographie |
›Abhandlung‹ Kant 1757: => Varenius 1650, Buffon 1750, Lulofs 1755. |
[Anhang: letztes Hauptstück] Varenius 1650. |
||
| Teil 2: Naturgeschichte |
Mensch [ohne direkte Vorlage] |
Tiere Pontoppidan 1753-54, Halle 1757. |
Pflanzen [eigene Struktur] |
Mineralien Justi 1757. |
| Teil 3: Geographie |
Asien Salmon 1732 ff., SnmR: (Gmelin 1751-52) |
Afrika Ludolf 1684-94, Colbe 1745, Salmon 1748, AHR (1749-51): Bde. 2-5 & 8. |
Europa Keyßler 1740-41; Büsching 1754. |
Amerika / Eismeer AHR (1751-59): Bde. 9, 12, 13, 16 & 17 / Müller 1758. |
Im Nachhinein ist insbesondere auffällig, daß drei für
Teilbereiche der Vorlesung extensiv herangezogene, explizite Lehrbücher weder
in der Programmschrift von 1757 noch im ausgearbeiteten Konzept der
Vorlesung (Ms Holstein) genannt werden:
Büsching 1754 (=> Europa), Halle 1757 (=> Tierreich), Justi 1757 (=> Mineralreich).
⇒ [Liste der literarischen Vorlagen];
⇒ [Zum Text des Ms Holstein].
Datum: 02.06.2008 / .../ 01.12.2015 / 12.08.2016