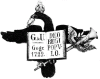 |
Handschriften zu und nach der Vorlesung über Physische Geographie: Beschreibung ›Ms Dohna‹ Fundort: Privat |
0. Zu Auffindung, Provenienz und Grundlage der Transkription
Arnold und Elisabeth-Maria Kowalewski (Hgg): Philosophischer Kalender für 1925 im Zeichen Immanuel Kants (Berlin 1925) [164 S.].
- S. 147: »Nun fand ich im Sommer des vorigen Jahres [d. i. 1923 - W_St] inmitten der reichen Kollegheftschätze des Grafen zu Dohna-Wundlacken eine Nachschrift aus der Logik des Mag. Pörschke vom Wintersemester 1791/92.«
- S. 156: »Ein glücklicher Handschriftenfund in Wundlacken bei Königsberg
ermöglichte mir selbst die Lehrtätigkeit Kants in umfassenderer Weise urkundlich
zu beleuchten. Es gelang aus den Nachschriften des Grafen Heinrich zu Wundlacken (1777 in
Mohrungen geb., 1843 in Königsberg gest.) eine vollständige Reihe von
Kollegheften herauszuheben, die ein interessantes Bild von Kants philosophischem Hauptkursus
abgeben. Der Nachschreiber stand trotz seiner Jugend auf einer hohen Bildungsstufe, hatte
einen erwachsenen Studienleiter zur Seite, so daß eine korrektere
Kollegheftführung garantiert war. So entschloß ich mich die ›Die
philosophischen Hauptvorlesungen Immanuel Kants nach den neu aufgefundenen Kollegheften
des Gr. H. z. Dohna-Wundlacken‹ (1924, Rösl & Cie, München und
Leipzig) herauszugeben. Nur die ›Physische Geographie‹ blieb ausgeschlossen,
da der Inhalt z. T. sehr veraltet ist. Dafür bringt nun unser Kalender aus diesem
ungedruckten Hefte einige charakteristische Proben.«
- Tatsächlich werden mittels Überschriften (S. 94-101 des Buches) fünf Abschnitte der Handschrift (Ms Dohna, pp. 61-64, 155-157, 122-125, 144-145, 189) in modernisierter Orthographie präsentiert. Nur die erste Passage ›Von der Gesundheit oder Schädlichkeit der Luft‹ stammt nicht aus dem naturgeschichtlichen, mittleren Teil der Vorlesung.
- Das ehemalige Gut Wundlacken der Grafen zu Dohna lag wenige km südwestlich von Königsberg, unweit des Frischen Haff.
Wilhelm Eitel: Ein Dokument zur Behandlung mineralogischer Gegenstände in Kants Vorlesungen über physische Geographie, in: Immanuel Kant. Festschrift zur zweiten Jahrhundertfeier seines Geburtstages. Herausgegeben von der Albertus-Universität in Königsberg i. Pr. (Leipzig 1924), S. 27-39.
- S. 33-39 werden p. 195-206 der Handschrift abgedruckt; d.h. das vierte Hauptstück
›Von den Mineralien‹.
Mit erheblichem typographischem Aufwand wird die dem Manuskript eigene Anordnung von Überschriften, Marginalien, Zeilenfall, Zusätzen und Skizzen nachgebildet [Beispiel]. Die begleitenden Anmerkungen des Herausgebers erläutern kompetent die Sache und widmen sich der Entzifferung der nicht immer leicht zu lesenden Handschrift.
Helmuth von Glasenapp: Kant und die Religionen des Ostens (Kitzingen / Main 1954)
- S. 91 ist ein kurzer Auszug (p. 208-210) des China betreffenden Abschnitts wiedergegeben: ›Peking ...‹
Dank freundlicher Vermittlung von Ludwig zu Dohna (München) sind zu Beginn der 1980er Jahre von sämtlichen erhaltenen Kant-Nachschriften der Grafen Dohna durch die Universitätsbibliothek Marburg Filmreproduktionen für das damalige Marburger Kant-Archiv angefertigt worden. Auf einen solchen SchwarzWeiß-Film und eine kurze Autopsie gehen die im Folgenden enthaltenen Angaben zurück.
1. Die äußere Beschaffenheit
Der sorgfältig angelegte Papp-Band in Quartformat zeigt nur eine, überwiegend Current schreibende Hand; Fremdworte und Eigennamen sind meist in der heute üblichen lateinischen Ausgangsschrift festgehalten; Buchstaben des griechischen Alphabets sind sehr selten (pp. 30, 90R, 204R, 225). Beginnend mit einem nicht paginierten Titelblatt setzt eine Zählung von 31 Bogen ein (von A bis FF); der Bogen zu acht Seiten; fehlende Bezeichnungen: I (p. 63), J (p. 71), Q (p. 119), U (p. 151), CC (p. 215). Die Bogenbezeichnung ›DD‹ ist p. 233 über eine vorhergegangene ›CC‹ gesetzt. Die stets beidseitig beschriebenen Blätter sind je oben außen konsequent gezählt von 1 bis 243; die letzte Textseite ist die fünfte des Bogens FF; die verbleibenden drei Seiten sind nicht benutzt. Zusammen mit dem Titelblatt, auf dessen Rückseite ein dreispaltiges Inhaltsverzeichnis zu lesen ist, enthält der Band also 245 beschriebene Seiten. - Das in einigen Blättern sichtbare Mühlenzeichen lautet: TRUTENAU. Die durchweg geraden Kanten der Blätter zeugen von einem sauberen - nach dem Vorgang der Bindung - ausgeführten Beschnitt; p. 154 sind die anzunehmenden Ziffern »48« des Stundenzählers durch Beschnitt verloren. - Kustoden finden sich weder an Seiten- noch Bogen-Übergängen.
Bei der Niederschrift des Textes werden ein breiter äußerer und ein schmaler innen liegender Rand beachtet; beide sind durch gerade Hilfslinien vorbereitet. Die Schriftdichte ist nur anfangs kompreß; zudem sinkt die Anzahl der Zeilen je Seite zunehmend - von zunächst 24 auf schließlich 15, 16 oder gar 14 (p. 157f.). Damit einher geht eine flüchtigere Buchstabenbildung. Abbreviaturen im technischen Sinn und Siglen sind hingegegen nur spärlich (für ›und‹ und ›durch‹) gebraucht (Ausnahmen; p. 8: das alchemistische Zeichen für Wasser und einige Währungseinheiten). - Zahlreiche weitere Eigenarten der Handschrift als solcher lassen auf einen sorgfältigen und routinierten Schreiber schließen; dazu zählen insbesondere:
- Die Tatsache, daß während des Schreibvorgangs nur wenige Korrekturen vorgenommen worden sind; Schreibversehen im eigentlichen Sinn sind kaum zu verzeichnen. Die Aufmerksamkeit des Schreibers galt dem Schreibvorgang als solchem.
- Der u-Haken der deutschen Currentschrift geht sehr häufig unmittelbar in den Folgebuchstaben (bevorzugt mit Oberlänge) über; z. B. in den Wörtern: auf, Luft oder Schutz.
- Das End-s hat eine deutliche, gegen die Schreibrichtung gewendete Oberlänge; bei flüchtiger Schrift, die für eine hohe Schreibgeschwindigkeit spricht, degeneriert das End-s sogar zu einem auffällig erhabenen Haken (zwei rechtwinklige Geraden).
Weitere durchgängige Merkmale sind:
- Das Titelblatt startet mit der Angabe: »angefangen den 28ten April
von 8-10«. Es folgt ein als Stundenzähler ausgeführter Kalender,
gelegentlich begleitet von Angaben zu Uhrzeit und Datum; beginnend p. 3 mit
»2te Stunde«; zuletzt p. 236 »62ste u. lezte Stunde / 9-10
Sonna[bend] den 22sten Sept.«. - Diese Kalendereinträge sind durchweg
nachträglich angebracht; sie sind stets in den inneren oder äußeren Rand
einer Seite gesetzt. Insgesamt ist der Kalender als fiktiv anzusehen, denn er ist weit
überwiegend dem Text nur äußerlich beigeordnet; die sachliche Abhandlung
zeigt keinerlei Bezug zu den (angeblichen) Lehrstunden. - Ein Vermerk für die Stunde
Nr. 23 fehlt zwischen p. 54 und p. 62.
Die Vorlesung wird wöchentlich vierstündig an den akademischen Nebentagen Mittwoch und Samstag gehalten; 62 gezählte Stunden sind demnach auf rund 15 Wochen zu verteilen. Für die Spanne zwischen dem ersten (28. April) und dem letzten (22. September) Tag ergeben sich jedoch 22 Wochen. Die Differenz erklärt sich durch eine weiter unten (3. B.) thematische Marginalie. - Demnach kann der Kalender - wenn auch nur näherungsweise - zur Bestimmung eines Datums für die Behandlung eines Themas im Verlauf des Semesters in Anspruch genommen werden. - Zahlreiche, teils umfängliche Marginalien und andere Text-Zusätze, die nach der Niederschrift des Grundtextes ein- oder angefügt worden sind. Häufig sind diese durch paarige Verweiszeichen (eines in oder über einer Textzeile) dem Grundtext präzise zugeordnet.
- Insgesamt sind 13 Skizzen (Zeichnungen) enthalten; sie begleiten vorwiegend im ersten
Teil (pp.: 8, 15, 16, 35, 65, 74, 82, 89) der Vorlesung als Marginalie den Text.
Zusätzlich werden p. 153: (1) die schlängelnd sich windende Bewegung
einer Seeschlange und (2) eine sich aufrichtende Landschlange im fortlaufenden Text
dargestellt; p. 156 wird mit zwei kleinen fischartigen Umrissen der nebenstehende
Text verdeutlicht (unterschiedliche Arten der Verarbeitung von Heringen auf See).
P. 201 soll schließlich der Längsschnitt eines Brillantschliffs von
Edelsteinen gezeigt werden. - Letztere wohl ebenso im Ms Crüger, d. i.
Ms 2596 der früheren Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg;
vgl. Adickes 1911.
Besonders hervorzuheben sind zwei dieser im Transkript durch das Wort ›Skizze‹ ersetzten graphischen Elemente:
p. 8: die sehr fein ausgeführte Darstellung einer Taucherglocke;
p. 65: die detaillierte Zeichnung einer Rosa nautica (Windrose).
Keines dieser Elemente ist ein Specificum oder eine Novität des Ms Dohna; die Taucherglocke findet sich auch im Ms Pillau und dem anonymen Ms 2582b der früheren Staats- und Universitätsbliothek Königsberg (vgl. Adickes 1911); beide gehen auf die 1780er Jahre zurück. Eine sehr einfache Darstellung der Rosa nautica findet sich schon im Ms Hesse, p. 65. Während die Windrose als Gemeingut gelten kann, ist für die Taucherglocke ein nicht ermitteltes Muster anzunehmen; ein Lehrbuch der Physik?
2. Die innere Struktur
| Teil 1, p. 001ff. [Physische Geographie] |
Teil 2, p. 098ff. [Naturgeschichte] |
Teil 3, p. 207-243 [Geographie] |
|---|
Der Gliederbau zeigt eine eigentümliche Mischung von Alt und Neu zugleich: Einerseits wird die seit dem Ms Kaehler (1775 - Tractatio: Sectio I / Sectio II) eingeführte Zweiteilung der Vorlesung als Ganzer befolgt - freilich erstmals bezeichnet als ›Elementarlehre‹ (p. 7) und ›Methodenlehre‹ (p. 98). Andererseits greift der namengebende erste Teil zurück auf eben die formale Gliederung des Kantischen Konzepts zur Vorlesung, die der Kantischen Programmschrift von 1757, dem Ms Holstein (1757/59) und anderen Manuskripten des Typs A0 eigen ist. Die Anzahl der ausdrücklich so bezeichneten ›Hauptstücke‹ ist im Ms Dohna freilich nur acht und nicht neun; Grund dafür ist die Zusammenfügung zweier einstigen Hauptstücke ›Quellen und Brunnen‹ und ›Flüsse und Bäche‹ unter der neu eingeführten Rubrik: »Hydrographie«. Trotz einer weitgehenden Beibehaltung des Wortlauts der Überschriften macht der Text der Handschrift jedoch weder Anleihen bei dem Druck des Jahres 1757 noch dem handschriftlichen Konzept des Ms Holstein (1757/59). Inhaltliche Ähnlichkeiten sind freilich allenthalben gegeben. - Die einleitenden ›Prolegomena‹ (p. 1-6) bieten die schon im Ms Kaehler gegebenen zwei Abschnitte: Auf eine allgemeine, wissenschaftstheoretische Reflexion folgen mathematische Vorbegriffe.
Der zweite Teil (p. 98-207) präsentiert mit der üblichen Reihenfolge: Menschen, Tiere, Pflanzen, Mineralien. Jedoch wird - in Überschriften - eine geänderte Einteilung vorgestellt: Die etablierten drei Reiche der Natur (u. a. Linné 1758) werden - wohl in Anpassung an Gegebenheiten neuerer Lehrbücher (u. a. J. Chr. P. Erxleben 21773 und Blumenbach 1779/80) - einer Zweiteilung unterworfen. Die ›Produkte der Erde‹ (p. 98) »liessen sich in die der organisirten und unorganisirten Natur theilen«. Die anschließende Darstellung bleibt davon jedoch unbeeindruckt bis auf:- (1) Für die Mineralien wird die Überschrift ergänzt um den Zusatz (p. 195): »Zweiter Abschnitt: von den unorganisirten Produkten der Natur«.
- (2) Eine p. 98f. vorweg zu lesende »Allgemeine Bemerkungen«, die für die Tiere eine weitere, neuere Einteilung nennen: Säugetiere und Vögel.
Auch im - sachlich - dritten, dem geographischen Teil sind strukturelle Neuerungen zu beobachten: Die asiatischen Regionen werden auf rund 17 Seiten zwar in eben der Reihung vorgestellt, die schon im Ms Dönhoff (1782) gegeben ist. Unter ›Afrika‹ wird die südliche Kap-Region jedoch erstmals an das Ende des kurzen Stücks (p. 230-235) und nicht an den Beginn gerückt. ›Amerika‹ wird erstmals von Nord nach Süd vorgestellt, Ein neuartiger Schluß stellt (p. 241-243) Inselregionen der diesem benachbarten großen Ozeane eigens heraus: Antillen und Südsee.- Im gesamten geographischen Bereich sind - nur sehr wenige sachliche Neuerungen oder Ergänzungen zu verzeichnen: Personennamen und meist damit verbundene Hinweise auf Literatur.
3. Einzelheiten
-
Querverweise
p. 16 ⇐ p. 15 [explizit auf Seitenzahl]
p. 34 ⇐ p. 31R
p. 38 ⇐ p. 37R ??
p. 53 ⇐ p. 27
p. 107 ⇐ p. 100 ??
p. 119 ⇒ p. 120ff
p. 119 ⇒ p. 137-139
p. 119 ⇒ p. 120
p. 152 ⇒ p. 152 ??
p. 241 ⇐ p. 218
- Externhinweise
- p. 95R: »Siehe Astronomie von Schultz«.
Ein entsprechendes Lehrbuch hat der Königsberger Mathematiker Johann Schultz (1739-1809) erstmals mit der Jahreszahl 1806 erscheinen lassen: ›Populäre Anfangsgründe der Astronomie‹ (Königsberg: Nicolovius 1806). Dohna ist am 15. Juni 1791 als Student immatrikuliert worden; einschlägige Vorlesungen hat Schultz sowohl für den Sommer 1791 als auch für den Winter 1791/92 angekündigt (Oberhausen / Pozzo 1999); so daß der Vermerk, sofern er etwa zeitgleich mit den übrigen fortlaufenden Marginalien erfolgt ist, vermutlich auf das öffentliche Kolleg über ›Trigonometriam et Astronomiam‹ des dem Sommer 1792 vorausgehenden Winters zu beziehen ist. - p. 132R für den 14. Juli: »NB Hier fing Kant seine Ferien an, welche 5
Wochen währten.«
Diese rückblickende Angabe paßt zu den in Königsberg zur Mitte des Sommersemesters üblichen ›Hundstagsferien‹. In der Folgestunde, am 22. August, wird mit dem ›baktrianischen Kamel‹, eine bereits begonnene Betrachtung der Kamele fortgesetzt. - p. 237R: »Siehe Anthropologie P. 68«. Der Vermerk steht neben einem kurzen
Bericht über nordamerikanische Indianer:
»Sie nennen sich nach den Thieren welche sie im Wapen führen Wölfe, Fische, Bären, Biber, und schreiben so Hieroglifen in Bäume«Das sehr ähnlich angelegte, sich selbst auf den Winter 1791/92 datierende Dohna-Manuskript der Kantischen Anthropologie-Vorlesung zeigt auf p. 68 in einer Marginalie zu ›Symbole‹ den folgenden Text:
- Es »haben auch die amerikanischen Wilden die nicht schreiben können, die Gewohnheit,
durch Symbole ihre Thaten in Baumrinde zu schreiben, Z. E. [Zeichnung] d. h. ein Mann (von der
Nation der Biber) (mit Namen Dreipfeil) (vom Stamm der Bären) (hat 3 Männer
umgebracht)«
Zum Zeitpunkt der Anbringung dieses Marginalvermerks im Ms der Physischen Geographie muß das Anthropologie-Manuskript bereits vorgelegen haben; ebenso der nächste Punkt. - p. 109 neben dem Stichwort ›Cretins‹ der sichtlich nachgeschobene Vermerk: »Siehe Anthropologie«
- Auch dieser Verweis läßt sich im Anthropologie-Ms lokalisieren;
- p. 98: »In den Schweizergebürgen wohnet eine Menschenart, die Cretins
genannt, sie haben eine gänzliche Unfähigkeit im Gebrauche des Verstandes. Ihre
Wohnplätze sind im Walliserland, und dem angrenzenden Savoyen, wo keine rechte
Circulation der Luft statt findet.«
- p. 95R: »Siehe Astronomie von Schultz«.
- Lücken
p. 187 ⇒ ???.
p. 196 ⇒ 21 (nach Eitel 1924). - Gestrichenes
Bei den im Transkript als ›Gestrichen‹ markierten Stellen handelt es sich überwiegend lediglich um einzelne Buchstaben oder Silben.
Die nächst größere Gruppe besteht aus kurzen Wörtern, pp.: 3 (3) / 18 / 30 / 34 / 41 / 46 / / 47 / 60 / 61 / 72 / 74R / 86 / 97 / 99 / 112 / 116 / 122 / 130 / 148 / 163 / 172 / 181 (2) / 194 / 194R / 216 / 224 / 234 / 241.
Darunter Indizien, die für eine Abschrift charakteristisch sein können, auf den folgenden Seiten, pp.: 3 / 41 / 60 / 61 / 99 / 172 / 194 / 194R / 216 / 234.Von diesen sind in besonderer Weise auffällig und aufschlußreich:
(1) p. 172 wird über eine Jagdtechnik am Kolymastrom (Sibirien) berichtet: Der Jäger führt Gänse - versteckt unter einem gefiederten Umhang - in eine Falle. Bei der Beschreibung dieses Vorgangs unterläuft ein Versehen, indem dieses Verfahren mit einem anderen - gleichfalls auf Täuschung beruhenden und in wärmeren Gefilden der Erde angewendeten - vermischt wird. Die im Grundtext begonnene Formulierung wird dadurch unverständlich:- »der Mensch stekt nemlich den Kopf in einen hohlen
Kürbis alle Gänse nach;«
Mittels Streichung und Interlinearzusätzen wird geändert in: - »der Mensch stekt sich nemlich ganz in Gänsehäute denn folgen ihm alle Gänse nach;«
Die nebenstehende Marginalie enthält die gestrichenen Worte in sachlich korrektem Kontext:- »Auch werden die Enten durch Schwimmer gefangen, welche den Kopf in einen hohlen Kürbis stecken, und denn eine nach der andern bei den Füßen in einen Sak ziehen.«
Offenbar haben dem Schreiber beide Darstellungen bereits schriftlich vorgelegen, als er mit der Anfertigung des Grundtextes beschäftigt war; vermutlich in ähnlicher Weise, wie dies im Ms Dönhoff f. 147 (Gänse am Eismeer) und f. 149 (Enten im Nil) der Fall ist.
(2) p. 41 wird das Adjektiv ›vulkanischen‹ am Ende der fünften Zeile offenbar deswegen gestrichen, weil es schon eine Zeile zuvor und zwar korrekt niedergeschrieben war; der Blick des Schreibers ist an dieser Stelle versehentlich eine Zeile zurückgesprungen; er bemerkt sein Versehen, streicht das Wort und setzt korrekt in der folgenden sechsten Zeile fort mit ›gebranntem Thon‹. - »der Mensch stekt nemlich den Kopf in einen hohlen
Kürbis alle Gänse nach;«
- Einzelbeobachtungen:
- Sowohl in Text und Marginalie wird der Vortragende namentlich genannt;
pp.: 27 / 32 / 124 / 132R / 136.
Darunter (p. 124) ein sonst nicht überliefertes biographisches Detail: Kant habe zur Zeit des Preußischen Königs Friedrich Wilhelm I (gestorben: 1740) noch selbst einen mittlerweile in Preußen nicht mehr vorkommenden ›Auerochsen‹ gesehen. - Der Text nimmt (p. 79) Bezug auf eine nahe Königsberg beobachtbare geologische Formation: »Der ganze Weg am Brandenburger Thor ist sichtbar das ehemalige Ufer des Pregels welcher eine fürchterliche Breite und Tiefe gehabt haben muß, denn seine entgegengesezte Ufer waren vermuthlich die Höhen an der neuen Bleiche.« - Gemeint ist das in der Eiszeit geformte Urstrom-Tal: Die ›Neue Bleiche‹ lag außerhalb der Stadtmauern gen Westen und am nördlichen Ufers des Pregel. Das ›Brandenburger Tor‹ liegt dem gegenüber, südlich des Pregel unterhalb des ›Haberbergs‹.
- Gelegentlich wird eine binäre Nomenklatur (nach Linné) benutzt, z. B.: pp. 151 / 165 / 175 / 181.
- In den Marginalien sind keine Anhaltspunkte ermittelt, die eine vom Grundtext abweichende Datierung erzwingen.
- Das seit 1945 verschollene, anonyme Ms 1729 der Königsberger Staats-und
Universitätsbibliothek ist - gemäß den von Erich Adickes (1911,
S. 268-276) überlieferten Angaben - auf denselben Sommer 1792 zu datieren, wie
dies durch den Schreiber für das Ms Dohna geschehen. Die Mehrzahl der von Adickes
ermittelten literarischen Bezüge des Ms 1729 gilt auch für das Ms Dohna;
vgl. dazu die entsprechende Zusammenstellung. So hat es (p. 94R) z. B. auch den
unüblichen Hinweis auf die »Sommerferien«. - Der Terminus a quo ist
für beide Handschriften mit Verweisen auf bestimmte Werke gegeben:
- Ms Dohna, p. 212 / William Robertson 1792;
- Ms Dohna, p. 234 / Robert Norris 1791, in: MmnR, Bd. 5;
- Ms Dohna, p. 30 / p. 213 / James Bruce 1790/91.
- Sowohl in Text und Marginalie wird der Vortragende namentlich genannt;
pp.: 27 / 32 / 124 / 132R / 136.
4. Summarische Charakteristik
Abgesehen von einigen interessanten Details ist das wenig umfangreiche (ca. 42.000 Worte) Ms Dohna für die Rekonstruktion einer sukzessiven Konstitution des Textes einer Nachschrift von hohem Wert; für die im gegebenen Fall auch die Mitwirkung eines (erfahrenen?) Hofmeisters zu berücksichtigen ist. Hat dieser z. B. selbst einige Jahre zuvor die Kantische Vorlesung gehört, oder besitzt er gar die Nachschrift einer solchen Vorlesung, so sind gelegentliche Rückgriffe auf einen vielleicht deutlich früher entstandenen Text naheliegend.
Als Quelle zur Information über eine etwaige innere Fortentwicklung der Vorlesung für die Jahre nach dem Ms Dönhoff (1782) kann der Nachschrift Dohna jedoch nur ein - im Vergleich zu den vorausgehenden Text-Zeugen Hesse, Kaehler, Messina und Dönhoff - deutlich abfallender Wert zugemessen werden.
Datum: Mai / Juli 2018 / 22.08.2018 / 05.10.2018 / 02.08.2019