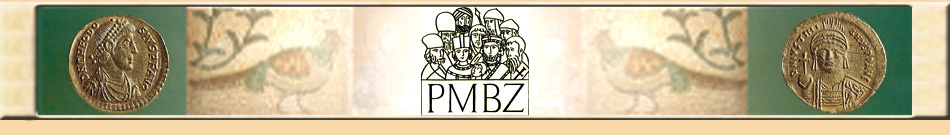Geschichte des Akademienvorhabens:
In den Jahren 1989/90 ergab sich dann aufgrund des Zusammenbruchs der DDR und der deutschen Wiedervereinigung auch an der damaligen Akademie der Wissenschaften die Möglichkeit, die projektierte “Prosopographia Byzantina” wieder aufzunehmen und als sinnvoll erweiterte “Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit” (PmbZ) ins Werk zu setzen. Aus diesen Gegebenheiten entwickelte sich das endgültige Projekt, nämlich die Erstellung einer Prosopographie des byzantinischen Reiches und seines Einflußgebietes für den Zeitraum von 641 bis 1025.
Dieses Projekt wurde in das Akademienprogramm aufgenommen und als Akademienvorhaben "Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit" an der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, zunächst seit 1992 im Rahmen der Koordinierungs- und Aufbauinitiative in den neuen Ländern, seit 1994 an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften realisiert.
Zunächst wurden unter der Leitung von R.-J. Lilie die Voraussetzungen geschaffen, um ein solches Projekt auf höchstem technischen Niveau verwirklichen zu können. Es wurden leistungsfähige Computer und Programme angeschafft und ein elektronisches Netzwerk eingerichtet. Das ausgewählte Datenbankprogramm wurde an die speziellen Erfordernisse der prosopographischen Erfassung und Weiterbearbeitung angepaßt, und die Mitarbeiter wurden in die Software eingearbeitet. Das Vorhaben verfügt derzeit über fünf Computer-Arbeitsplätze, die über ein Netzwerk miteinander verbunden sind und den einzelnen Mitarbeitern den gleichzeitigen Zugriff der einzelnen Mitarbeiter auf die verschiedenen Datenbanken erlauben, die auf einem zentralen Server liegen.
Die Datenaufnahme gestaltete sich so, daß die verschiedenen Quellen zunächst für die Abteilung I der PmbZ, d. h. den Zeitraum von 641–867, durchgesehen und alle in ihnen enthaltenen personenbezogenen Informationen in die Datenbank eingetragen wurden. Diese Arbeit konnte 1998 abgeschlossen werden. Sie war deshalb besonders kompliziert, weil die Quellen zur mittelbyzantinischen Zeit einerseits recht zahlreich sind, und andererseits auch große Bereiche umfassen, die noch nicht kritisch aufgearbeitet sind und eigene, grundlegende Forschungsarbeit erforderlich machen. Diese Forschungsarbeit war – und ist – in vielen Fällen für die Quellenerfassung absolut notwendig, geht jedoch über die eigentliche prosopographische Arbeit hinaus. Bis zum Jahre 1998 wurden über 700 Quellen unterschiedlichster Art aufgenommen, wobei der Umfang der einzelnen Quellen von kurzen Siegel- und Münzlegenden bis zu Texten von 1.000 Seiten und mehr reicht. Insgesamt wurden Quellen aus zehn verschiedenen größeren Quellenkategorien durchgesehen: Historiographie, Epistolographie, Konzilsakten, Hagiographie, Homiletik, Fachschriften, Listen, Siegel, Inschriften und Münzen.
Neben den griechischen Quellen wurden auch lateinische und – in Übersetzungen – Quellen aus weiteren sieben Sprachen berücksichtigt: armenische, georgische, syrische, arabische, koptische, hebräische sowie Quellen aus dem slawischen Raum.
Außer den Quellen war auch die für dieses Gebiet und diese Zeit relevante Sekundärliteratur auszuwerten. Ihr Umfang kann kaum quantifiziert werden. Einen gewissen Eindruck kann das Abkürzungsverzeichnis für die erste Abteilung vermitteln, das außer den Quellen nur solche Werke aus der Sekundärliteratur enthält, die mit einer eigenen Abkürzung zitiert werden, und das insgesamt achtzig Druckseiten umfaßt. Die “kleineren” Werke aus der Sekundärliteratur (im wesentlichen Aufsätze und Lexikonartikel) sind im Abkürzungsverzeichnis dagegen nicht enthalten, sondern werden nur in den einzelnen Lemmata mit Angabe von Zeitschrift, Jahr und Seiten angeführt.
Im Sommer 1998 erfolgte ein Kontrolldurchgang durch die Datenbank und die Erstellung der Personenliste mit der endgültigen durchgehenden Nummerierung. Insgesamt enthält die Datenbank der ersten Abteilung etwas über 11.000 Datensätze mit ca. 11.500 Artikeln.
Diese Artikel wurden in insgesamt fünf Büchern publiziert, die jeweils zwischen 650 und 700 Druckseiten umfassen. Hinzu kommen vier gedruckte Indices mit zusammen etwa 500 Seiten sowie ein elektronischer Index.
In einem einleitenden Band “Prolegomena” wurden die für die Prosopographie ausgewerteten Quellen allgemein und unter spezifisch prosopographischen Gesichtspunkten vorgestellt und diskutiert. Daraus entstand eine ausführliche, prosopographisch orientierte Quellenkunde für das 7. bis 9. Jahrhundert. Daneben enthält dieser Band ein Abkürzungs- und Literaturverzeichnis sowie eine Handreichung für die Benutzung der PmbZ.
Außerdem sind in der begleitenden Reihe der “Berliner Byzantinistischen Studien” bisher sechs Bände erschienen, von denen die ersten beiden die politische Geschichte der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts aufarbeiten, während der dritte und vierte Band sich hagiographischen, biographischen und epistolographischen Problemen widmen. Der fünfte Band enthält eine Geschichte der Patriarchen der Zeit zwischen 715 und 847, und der sechste und bisher letzte widmet sich einer wichtigen religiösen Kontroverse im 7. Jahrhundert.
Es ist darauf hinzuweisen, daß das Akademienvorhaben für seine Publikationen nicht nur das Manuskript bereitstellt, sondern auch selbst für die typographische Gestaltung und das Seitenlayout verantwortlich ist. Abgesehen von der Mehrarbeit war dafür auch eine Einarbeitung in ein Layoutprogramm erforderlich. Die Daten wurden zunächst aus der Datenbank in ein Textverarbeitungsprogramm (Microsoft Word) exportiert, dort weiter bearbeitet und schließlich in ein Layoutprogramm (FrameMaker) konvertiert, in dem dann die endgültige Druckvorlage hergestellt wurde. Diese Druckvorlage wurde in digitalisierter Form als Postscriptdatei an den Verlag geliefert. Der Zeitaufwand für die Herstellung eines Bandes von 650 bis 700 Seiten liegt bei etwa sechs Monaten, die notwendigen Korrekturdurchgänge mit eingerechnet.
Als Ergebnisse liegen jetzt vor: die Prolegomena zu Abteilung I sowie die sechs Bände der eigentlichen Prosopographie, von denen Band VI das vollständige Abkürzungsverzeichnis, Addenda und die Indices enthält. Außerdem sind die schon genannten “Berliner Byzantinistischen Studien” zu nennen. Des weiteren veröffentlichten die Mitarbeiter zahlreiche Aufsätze in verschiedenen einschlägigen Zeitschriften und Publikationen.
Als weiteres Ergebnis ist seit Februar 2003 ein elektronischer Index zu den publizierten Bänden im Internet zugänglich (http://pmbz.bbaw.de). Damit besteht die Möglichkeit, über das Internet nicht nur gezielt nach Namen und Namensvarianten, Titeln und Berufen, Ortsnamen und in bestimmten Quellen vorkommenden Personen zu suchen, sondern bei dieser Suche die verschiedenen Indices auch miteinander zu kombinieren. Auf diese Weise erhält der Benutzer, selbst wenn er zunächst keinen unmittelbaren Zugang zu den Büchern der PmbZ hat, die Namen der gewünschten Personen mit den dazugehörigen Nummern. Die entsprechenden Lemmata kann er dann gezielt in der gedruckten Fassung nachschlagen bzw. über Fernleihe in Kopie erhalten.
Im Jahre 2002 wurden die Arbeiten an der II. Abteilung der PmbZ aufgenommen, die den Zeitraum von 867 bis 1025 umfaßt. Die Arbeitsschritte sind dieselben wie bei Abteilung I. Zur Zeit werden die Quellen gesichtet und die Daten eingegeben. Die Publikation in Buchform soll bis zum Jahre 2010 erfolgen.