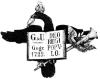 |
Vorlesung über Physische Geographie: Typologie /
I: Struktur Umschalten: => [Termini] / [Literatur] [Quantitäten] |
| Typ | Entstehung | Exemplar(e) / ROT: verschollen in Königsberg. Adickes, Hefte: [A - Z]; BLAU: von Adickes nicht eingesehen. |
Kurze Charakteristik |
|---|---|---|---|
| A0 | 1757/59 | Holstein / Ms S 94 / Ms 1869 / Ms 2582b [B] / [C] / [G] / [K] |
Von Kant selbst abgefaßter, sogenannter ›Diktattext‹ mit drei etwa gleich gewichteten Teilen; zu mehr als zwei Dritteln aus Exzerpten hervorgegangen; gestufte §§-Zählung im ersten Teil. |
| A1 | 1763/64 | Herder [A] |
Anscheinend im Hörsaal entstandene Notate des gesamten (?) mündlichen Vortrags in 8° und darauf basierende Ausarbeitung (nur zum ›ersten Teil‹ der Vorlesung) in 4°. |
| A2 | 1770 | Hesse [-] / |
Gleichmäßig dreiteiliges Ms; innerhalb des dritten, geographischen Parts: mit Europa, England und Preußen. |
| B0 | 1775 (?) | Kaehler, Werner, B-Rink [-] / [W] / [U] / |
Primär zweiteilig (Elemente / Producte) und nicht dreiteilig strukturiert mit durchlaufender §§-Zählung. Zudem:
|
| B1 | 1776 ? | Messina / Fehlhauer / Ms 2533 / Busolt / Wolter [M'] / [M] / [N] / [O] / [Z] |
Nur im ›ersten Teil‹ eigenständig gegenüber Typ B0; ohne §§-Zählung; mehrere Besonderheiten bei Wolter. |
| X1 | 1772ff. | Philippi / Friedländer / Ms S 73 / Powalski / A-Rink [-] / [D] / [E] /[F] / [U] / |
Compilation: Weit überwiegend Abschrift von A0; vor allem zu Beginn nicht deklarierte, spätere Einschübe vom Anfang der 1770er; Heft [D] enthält zudem eine Art Anhang zu allen Teilen aus der Mitte der 1770er Jahre. |
| X2 | 1780ff. | Barth / Pillau / Crueger [H] / [J] / [L] |
Compilation: Primäre Struktur ist dreiteilig; erhebliche Übernahmen aus A0; verschiedene Ergänzungen und Einschübe bis in die Mitte 1780er Jahre; Pillau und Crüger mit großen Anteilen aus C. |
| C0 | 1780er | Dönhoff / Puttlich [-] / [Q] |
Eigenständig strukturierter Text in drei Teilen; nur gering ausgeprägter ›dritter Teil‹, darin deutlich überwiegend zu Asien (China, Indien). [Q] (Puttlich) enthält in geringem Umfang auch Text aus C1. |
| C1 | 1785 ? | Volckmann [P] |
Mit Anteilen aus den Typen A0 und X2. |
| C2 | 1787 ? | Ms 2582a [R] |
Eigenständiger Text. |
| D0 | 1790 | -- | -- |
| D1 | 1791 ? | Bergk [-] |
Als gedruckter Auszug (1833) überliefert. |
| D2 | 1792 ? | Dohna / Ms 1729 [-] / [S] |
Besonderheiten von Dohna: dreiteiliges Ms, im ›ersten Teil‹ am Leitfaden von A0 bzw. der Programmschrift von 1757; fortlaufende Stundenzählung. |
| D3 | 1793 | Vigilantius [T] |
Eigenständiger Text. Nur fragmentarisch überliefert. |
Typologie: Darunter wird ein dem Biologen nachempfundenes Vorgehen verstanden: Tatsächlich vorgefundene Pflanzen (sive Texte) werden als Musterexemplare aufgefaßt, beschrieben und dargestellt. Andere Pflanzen können anhand derartiger Typ-Exemplare einer Gattung oder Art zugeordnet werden. Auf diese Weise kann eine komplexe Systematik (Taxonomie) aufgebaut werden. Erste Merkmale für die Fixierung eines Typs der Vorlesung sind der äußere Gliederbau und die Proportionen des Textes. Genauer beschrieben wird er durch die Feingliederung, eine ›charakteristische‹ Terminologie und letztlich den gesamten Text.
Zur Begründung für die Angemessenheit eines solchen Verfahrens sei hier nur daran erinnert, daß sämtliche höheren, sich geschlechtlich fortpflanzenden Organismen jeweils strikte Individuen sind: Es gibt zwar keine zwei exakt identischen Exemplare; dennoch doch läßt sich jedes vorgefundene Exemplar [sic!] einer bestimmen Art zuordnen. Ganz entsprechend liegen die Verhältnisse bei verschiedenen Handschriften, die auf eine Vorlesung zurückgehen sollen. Somit gilt die folgende hierarchische Kette: Nachschrift => Kant => Physische Geographie, => Typ => Exemplar und gegebenenfalls ›Spezifika‹. - Bloß chronologisch (in der Zeit der Anfertigung) differierende Exemplare werden durch Index-Ziffern in separaten Reihen kenntlich gemacht. Die Aufzählung verschiedener typgleicher, abschreibe-identischer Exemplare geschieht chronologisch von links nach rechts.
Im Blick auf die verschiedenen Textzeugen nach und zur Vorlesung über Physische Geographie findet ferner eine grobe chronologische Vorordnung statt: Typ A steht für das erste Konzept der Vorlesung. Dies Konzept (nicht unbedingt der Text!) war allem Abschein nach von den späten 1750ern an bis in die frühen 1770er Jahre bindend. Typ B ist Mitte der 1770er Jahre in genauer Abstimmung mit der neu etablierten Vorlesung über Anthropologie entwickelt worden. Typ C tritt zu Beginn der 1780er Jahre auf. Ob sich etwa 1790 ein strukturell deutlich anderer Typ D herausgebildet hat, kann angesichts der derzeitigen Überlieferungslage nur vermutet werden. Das Ms Dohna und die Struktur der nur sehr eingeschränkt benutzbaren Edition ›Vollmer I‹ (1801-1805) deuten auf eine neuartige Zweiteilung unter den Titeln ›Elementar-‹ und ›Methodenlehre‹. - Unter Typ X rangieren verschiedene Exemplare, die Texte unterschiedlicher Herkunft compilierend mischen. Eine knappe Zusammenstellung der Grundtypen vgl. hier.
Das beschriebene Vorgehen tritt an die Stelle eines vor allem in der Altphilologie entwickelten Verfahrens einer ›Stemmatisierung‹ oder ›Familienanalyse‹: Anhand vorgefundener Differenzen en detail (meist Abschreibefehlern) wird auf Entstehung und Verbreitung geachtet und so auf die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Texten geschlossen. Prinzipiell kommt hierbei jedem Detail das gleiche Gewicht zu. Implizite Voraussetzung für ein derartiges Vorgehen ist eine ›bloße‹ oder zumindest weit überwiegende Abschriftenrelation der verschiedenen Textzeugen. Hörernachschriften von thematisch oder strukturell sehr ähnlichen, semesterweise wiederkehrenden Lehrvorträgen erfüllen freilich eine derartige Bedingung nur in beschränktem Umfang. Diesem charakteristischen Unterschied Rechnung tragend nimmt eine typologische Analyse eine Gewichtung vor, sodaß Differenzen oder Identitäten im Detail auch als irrelevant eingestuft werden dürfen. Die analytische Leistungsfähigkeit der Typologie zeigt sich nicht zuletzt darin, daß sie zur unmittelbaren Umsetzung in eine simple html-basierte Darstellung sämtlicher Textzeugen als Volltext geeignet ist. Eine derartige Typologie ist kein bloß namengebendes Verfahren.
Eine solche Typologie kann auch einsichtig machen, welche Schwierigkeiten Erich Adickes (1866-1928) in den ersten Jahrzehnten des 20ten Jahrhundert bei seinen ›Untersuchungen zu Kants physischer Geographie‹ (Tübingen 1911) zu überwinden hatte; denn bei der Mehrzahl der ihm anfangs verfügbaren Handschriften handelt es sich um Mischformen (Typen X1 und X2). Erst durch das ihm 1913 verfügbare Ms Werner [W] war gesichert, daß der von Rink 1802 veröffentlichte Text weit überwiegend aus der Kompilation von nur zwei Traditionszügen entstanden ist. Das Adickes nicht verfügbare Ms Hesse hat erst in den 1990er Jahren unter anderem gezeigt,
- (1) daß zwar das frühe Konzept einer Vorlesung mit drei etwa gleichgewichtigten Teilen bis in den Beginn der 1770er Jahre gültig war, nicht aber der Text, und
- (2) daß der unmittelbar auf Kant zurückzuführende ›Diktattext‹ (Ms Holstein) ausschließlich durch Abschrift tradiert worden ist.
Im Blick auf den mündlichen Lehrvortrag bedeutet dies, daß die von Adickes für das Geschehen entworfene Szenario: Kant diktiere zunächst einen Text und kommentiere diesen in einem weiteren Schritt, allenfalls in den allerersten Jahren des Kollegs (vor den durch die Mss Herder überlieferten Jahren) stattgefunden haben kann. Im weit überwiegenden Zeitraum der Vorlesung hat Kant - nach Auskunft der vorhandenen Manuskripte - sicher ohne Bindung an diesen substantiell und strukturell sehr rasch veralteten Text vorgetragen.
Das erst im Frühjahr 2007 zugängliche Ms Dönhoff hat - ähnlich wie das Werner-Heft [W] im Jahr 1913 - die Situation deutlich vereinfacht: auch die Komposition der Kompilationen vom Typ X2 kann als weitgehend aufgeklärt gelten. Denn das Ms Dönhoff geht im Wesentlichen auf eine ›echte‹ oder ›ursprüngliche‹ Nachschrift, nämlich das originäre Produkt studentischer Nachschreiber mündlicher Semestervorträge zu Beginn der 1780er Jahre, zurück. Allerdings ist ausgeschlossen, daß das Ms-Dönhoff selbst ein solches Exemplar ist. Vielmehr deuten die Eigenarten der Handschrift als solcher darauf hin, daß es sich um eine Abschrift von einer Nachschrift handelt. [Dazu Stark 2017: Von Königsberg nach Friedrichstein]
Datum: 17.06.2007 / ... / 28.06.2016 / 29.08.2016